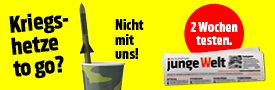»Warum gelingt es nicht, eine Bewegung für die Armen hinzukriegen?«
Interview: Alexander Reich
Sie waren 25 Jahre lang Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, gehen jetzt in Rente und haben ein neues Buch vorgelegt. Eine Abrechnung?
Nein, aber es hat etwas Resümeehaftes. Ich bin raus aus dem Tagesgeschäft und kann mich jetzt fragen: Wo warst du mit deiner Politik für Arme erfolgreich? Was hat überhaupt nicht funktioniert? Und warum eigentlich nicht? Ich gebe zu, das Buch ist aus einem Frust heraus geschrieben. Als ich vor 25 Jahren Hauptgeschäftsführer wurde, lag die Armutsquote bei zehn Prozent. Jetzt sind es 17 Prozent.
Das lag auch an Staatshilfen. Im Buch wird sehr genau nachvollzogen, wie jedes einzelne Hilfsprogramm in den Krisen der 2020er Jahre die Reichen reicher gemacht hat und die Armen ärmer.
Das ist so. Hunderte Milliarden Euro wurden so eingesetzt, dass diejenigen, die am wenigsten Probleme hatten, am meisten abbekamen vom Kuchen. Das war bei den Coronahilfen schon so. Vom Tankrabatt profitierten dann die mit dem größten Hubraum am meisten. Bei der Senkung der Strompreise waren es die mit dem größten Stromverbrauch, also nicht die armen Haushalte, sondern die mit dem zweiten Partykühlschrank, im Zweifel noch der Heimsauna und einem kleinen Pool. Dazu kamen diverse Programme zur Senkung von Einkommenssteuern. Wenn man alles zusammenrechnet, und guckt, was wohin geflossen ist, muss man zur nüchternen Erkenntnis kommen: Da wurde nicht nur sehr zielungenau gearbeitet. Da wurden nicht nur die Armen zuwenig entlastet, um über den Monat zu kommen. Sondern es wurde tatsächlich so umverteilt, dass die Gesellschaft durch diese Programme noch stärker gespalten wurde, als sie es ohnehin schon war.
Vom »Versagen einer Republik« ist im Buchtitel die Rede. Wer hat da genau versagt?
Nicht nur die Regierungen, also die Große Koalition und die Ampel. Versagt haben auch all jene Akteure, die 2022 einen heißen, wahlweise auch solidarischen Herbst initiieren wollten, um dafür zu sorgen, dass die Regierung so unter Druck kommt, dass sie letztlich eine solidarische Politik für die Armen und Schwachen machen muss. Das ist sowohl die linke Opposition im Bundestag gewesen als auch Gewerkschaften und Sozialverbände, die sich zwar redlich mühten, aber doch ziemlich viel falsch gemacht haben. Das muss man so sagen.
Was denn zum Beispiel?
Die Partei Die Linke wollte den »heißen Herbst« unbedingt schnell auf die Straße bringen, weil sich die AfD anschickte, gleiches zu tun. Also sind sie vorgeprescht, und alles war relativ ungeordnet. Es gab geradezu heiter anmutende Streitigkeiten, an welchem Wochentag die Demonstration stattfinden sollte: Montags, wo die Schwurbler schon auf der Straße sind? Oder doch lieber an einem anderen Wochentag? Dann gab es den Streit: Darf Sahra reden oder ist sie ausgeladen? Keiner wusste, was los ist. Die fast schon typische Zerrissenheit der Linken. Dazu kam, dass eine Forderung nach der anderen rausgehauen wurde, was sich zum Teil auch widersprach. Mehrwertsteuer absenken auf Lebensmittel, später speziell auf Hülsenfrüchte; Gaspreisdeckel et cetera. Auch das warf die Frage auf, warum mit den Milliarden nicht zielgenau die geschützt werden sollten, die es brauchten.
Wären die Montagsdemos gegen Hartz IV denn nicht eine guter Anknüpfungspunkt gewesen?
Die Montagsdemos waren immer ein stark ostdeutsches Phänomen. Und später wurden sie gekapert von Schwurblern und Rechten, die den Slogan »Wir sind das Volk« missbrauchten. Damit war das vorbei. Erfolg geht nur gesamtdeutsch. Man kann nicht aus dem Osten heraus Deutschland verändern. Das kann nicht mal die CSU von Bayern aus.
Und mit Sahra Wagenknecht hätten Sie auch nichts auf die Beine stellen wollen, oder?
Auf keinen Fall. Sahra Wagenknecht und ihre Gefolgschaft betreiben eine zutiefst nationale, fast nationalistische Politik, wo die deutschen Interessen auf einmal wieder ganz vorne stehen. Das ist nicht meine Auffassung von linker Politik. Meine Solidarität endet nicht an den deutschen Grenzen. Und sie schließt das ukrainische Volk mit ein, das sich dem Aggressor nicht ergeben will.
Die Linkspartei war also zerrissen in jenem Herbst. Wie war es mit den Gewerkschaften?
Denen ging es in erster Linie um steuerfreie Zuschläge bei den Tarifverhandlungen.
Die Möhre, die Kanzler Olaf Scholz ihnen hingehängt hatte.
Ja, wenn man so will. Aus Sorge vor großen Streiks hat er gesagt: Vereinbart Zuschläge; ich werde dafür sorgen, dass die steuerfrei bleiben. Er wollte damit Druck aus den Tarifverhandlungen nehmen. Das ist gelungen. Finanzminister Lindner, aber auch führende Gewerkschafter setzten sofort nach und sagten: Schöner Anfang, noch besser wären Maßnahmen zum Abbau der kalten Progression, sprich: echte Steuersenkungen. Auch darauf ist die Bundesregierung angesprungen. Das Paket war letztlich: steuerfreie Zuschläge, Steuerentlastungen und die sogenannte Gaspreisbremse. Das haben die Gewerkschaften durchgesetzt.
Der Kampf für Menschen in Grundsicherung und im Niedriglohnsektor blieb an den Sozialverbänden hängen?
Und an Verdi, muss man sagen. Verdi hat sich ausgesprochen solidarisch gezeigt mit denen, die am Rand stehen; die von steuerfreien Zuschlägen nichts haben, weil sie keine Arbeit haben. Oder die von einer Einkommensteuersenkung nichts haben, weil sie sehr wenig verdienen und kaum Steuern zahlen.
Verdi hat andere Mitglieder als die IG Metall.
Ja, die müssen sich auch um Pflegekräfte kümmern, die halbtags arbeiten und nur knapp über der Armutsgrenze sind. Aber das ist eine Tradition bei Verdi. Das habe ich all die Jahre schon bei Frank Bsirske erlebt (Verdi-Chef von 2001 bis 2019, jW): Solidarität auch mit denen, die erwerbslos sind.
Die sind ja oft genug völlig kaputt, unter Dauerstress, ohne jedes Selbstbewusstsein. Wie kriegt man diese Menschen auf die Straße?
Gar nicht. Wenn jemand wirklich Existenzsorgen hat, über beide Ohren in persönlichen Problemen steckt, vielleicht noch alleinerziehend ist und Angst hat, ob er morgen noch die Miete zahlen kann, werde ich den nicht für den Klassenkampf mobilisieren können. Das habe ich in Diskussionen mit Linken immer wieder gesagt: Um diese Menschen müsst ihr euch erst mal kümmern! Ich kann doch nicht jemandem, der Hartz IV beantragen muss, völlig ratlos vor den Formularen sitzt, vielleicht noch ein paar graue Briefe wegen versäumter Meldefristen bekommen hat – dem kann ich doch nicht mit ’ner Demo kommen. Dem muss in seinem Alltag geholfen werden. Deswegen muss eine linke Bewegung auch eine Bewegung von Kümmerern sein, sonst geht das gar nicht. Wenn dieser Mensch wieder Fuß gefasst hat, seine Alltagsprobleme überblicken kann, sich nicht mehr völlig ausgeliefert und hilflos fühlt, kann ich mit ihm sicherlich drüber reden: Hör mal, wie siehts aus, wär es nicht Zeit, dass wir politisch was ändern, damit du gar nicht mehr in eine solche Situation kommst? Aber erst dann.
Die sechs großen Sozialverbände haben zusammen zwei Millionen Beschäftigte und drei Millionen Ehrenamtliche. Warum hat das nicht für Massendemos gereicht?
Diese Verbände sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Der Paritätische hat in den letzten Jahren Ross und Reiter benannt, wenn es um Armut ging. Wir haben die Vorteilsnehmer benannt, und gesagt: Wer Armut bekämpfen will, muss auch übermäßigen Reichtum bekämpfen und Umverteilung einfordern. Aber den Schritt gehen nicht alle. Das Deutsche Rote Kreuz ist international in Hilfen eingebunden und verhält sich darum politisch neutral, gerade parteipolitisch. Die Arbeiterwohlfahrt ist im Gegensatz dazu ein Kind der SPD. Die sind formal unabhängig, aber da gibt es sehr enge Verbindungen. Die Caritas wiederum ist bürgerlich aufgestellt und war in ihren sozialpolitischen Anschauungen lange Zeit durchdrungen von eher neoliberalem Gedankengut. Diese Verbände werden niemals mit gemeinsamen Forderungen zusammen auf die Straße gehen, um Armut zu beseitigen, ausgeschlossen.
Auf den zweiten großen kirchlichen Verband, die Diakonie, wirft Ihr Buch ein Schlaglicht mit der Erinnerung an einen Demoauftritt von 2019.
(lacht) Das war ein richtiger Gag damals. Bei der Demo waren wir gemeinsam, »Stoppt TTIP« oder so. Ich war ungeheuer beeindruckt von deren Auftritt. So was Professionelles und Kreatives hatte ich bis dahin nur selten gesehen. Und einige Zeit später stellte ich beim Zeitunglesen fest: Das war ’ne Werbeagentur, die die eingespannt hatten. Und die hatte denen nicht nur das Outfit entworfen, sondern auch gleich die Demonstranten noch mitgeschickt.
Vor der Rente hätten Sie sich solche Bonmots verkneifen müssen, oder?
Ja, klar. Das kann ich jetzt schreiben, das hätte ich damals nicht mal kommentiert. Es ist am Ende bestenfalls drollig.

Aus dem heißen Herbst für die Abgehängten wurde jedenfalls nichts.
Die Bündnisstruktur war damals schnell so aufgesplittet und konfus, dass da im Grunde nicht mehr viel zu bewegen war. Wir hatten dann den »Tag der Solidarität«, den 22. Oktober, hatten große Demos geplant, und hier in Berlin kamen gerade mal 5.000 Menschen. Das hat mich richtig mitgenommen.
Es war der »absolute Tiefpunkt« in Ihrem Berufsleben, steht in dem Buch.
(lacht) Ja, will ich mal so sagen. Das war auch der Anlass zu sagen: Komm, jetzt lehn dich mal zurück und analysier mal. Nicht immer im Hamsterrad mitlaufen, sondern aussteigen, gucken: Warum gelingt es nicht, eine Bewegung für die Armen hinzukriegen?
Weil ihre Lobbyisten, die Sozialverbände, »nicht in die Speichen greifen« könnten, selbst wenn sie wollten, heißt es im Buch.
Sie können kurzfristig kaum Druck ausüben. Die Kapitalseite sagt: Oh, das könnte negative Auswirkungen auf die Beschäftigung haben, dieses Gesetz – und das reicht, um eine kleine Panik auszulösen im Kanzleramt. Gewerkschaften sind stark, weil sie viele Mitglieder erreichen. Bei Tarifauseinandersetzungen kommen oft direkt politische Antworten. Das haben wir in der Preiskrise gesehen. Ein Wohlfahrtsverband hat nichts Vergleichbares, das er ad hoc in die Waagschale werfen könnte. Ein Kitastreik vielleicht, aber das ist es auch schon. Das einzige, was uns bleibt, ist die Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Das ist mein Fazit. Professionelle, gute Pressearbeit ist für einen, der sonst nichts zu bieten hat, absolut unabdingbar. Als effizienteste Form der Öffentlichkeitsarbeit.
Da haben Sie es weit gebracht: Sie sind neben Verena Bentele vom Sozialverband Vdk der bekannteste Soziallobbyist hierzulande. Der mit den Koteletten und den Cowboystiefeln. Wie wichtig sind solche Markenzeichen?
(lacht) Nicht ganz unwichtig ist ein Wiedererkennungswert. Wenn immer neu gefragt wird: Wer ist der noch mal? Nie gesehen, ist man für die Medien möglicherweise nicht so interessant. Aber meine Koteletten und meine Cowboystiefel sind nicht aus Marketinggründen da, sondern einfach, weil ich sie liebe.
Was ist das Einmaleins guter Pressearbeit?
Ungeheuer viel Handwerk. Man darf die Zeit des Gegenübers nicht verschwenden. Wenn ich mich äußere, muss das sitzen, und nicht erst nach dem zehnten Anlauf. Dann braucht es Sachkenntnis. Ich muss in der Tat Bescheid wissen, worüber ich rede. Wenn ich erst für alles ein Briefing brauche, sollte ich es wahrscheinlich besser lassen. Weil ich dem nicht gewachsen bin. Man muss im Stoff sein. Das allerwichtigste ist eine professionelle Presseabteilung, die die Kontakte hält und einen auch mal zurückpfeift: Jetzt schießt du ein bisschen über das Ziel hinaus, sei vorsichtig an der Stelle. Und schließlich brauche ich als Grundlage, speziell im Verband, eine außerordentlich gute Gremienarbeit. Ich muss Beschlüsse haben. Ich kann ja nicht einfach frei rumfabulieren, und dann sagt mir mein Vorstand: So geht das nun aber nicht.
Also viel Vorbereitung und dann gutes Timing.
Genau. Ich muss Themen wie zum Beispiel das Bürgergeld auf dem Schirm haben, bevor sie überhaupt aufkommen. Wenn die Politik damit startet, muss ich die Grundlagenbeschlüsse bereits in den Gremien abgestimmt haben. Damit ich in der Presse agieren kann.
Ein Erfolg des Paritätischen war, immer wieder aufzuzeigen, mit welchen Tricks die Hartz-IV-Sätze kleingerechnet werden.
Das lief gut, ja. Es war ein Stachel im Fleisch eines jeden Sozialministers. Wir haben geguckt: Was müsste bezahlt werden nach der Logik des Ministeriums, wenn die auf alle Tricks verzichten würden bei der Berechnung, um Armen ihr Geld vorzuenthalten. Momentan wären es 813 Euro.
Damit wäre die Armut überwunden, heißt es im Buch.
Wenn wir die 813 Euro auch bei Kindern ansetzen, wären fast alle Haushalte über der statistischen Armutsgrenze. Kaum noch ein Haushalt hätte weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens. Die Kosten wären zu stemmen. Es wären rund 20 Milliarden Euro. Das etwa wurde für den Abbau der kalten Progression auf den Tisch gelegt. Aber eine solche Erhöhung der Regelsätze hätte zwangsläufig zur Folge, dass auch die Mindestlöhne deutlich angehoben werden müssten. Sonst würde der Staat ja nur den Niedriglohnsektor subventionieren und ein Heer von Aufstockern schaffen.
Spricht etwas gegen deutlich höhere Mindestlöhne?
Nein. Bei der Einführung des Mindestlohns von 8,50 Euro im Jahr 2015 haben das Münchner Ifo-Institut und viele andere vorhergesagt, man werde kein Taxi mehr auf deutschen Straßen finden. Kein Friseur würde einem noch zu einem annehmbaren Preis die Haare schneiden und so weiter. Vieles würde wirtschaftlich brachliegen, weil man es nicht mehr bezahlen könnte. Ich hatte mich damals gefragt, ob mein Friseur ins Ausland gehen und hoffen würde, dass ich dort zum Haareschneiden hinkomme. Oder ob die Post im Ausland meine Briefe verteilen würde. Das waren kuriose Diskussionen und im Effekt hatten wir mehr gute Beschäftigung als vor der Einführung des Mindestlohns. Deshalb glaube ich den Abwehrargumenten der Wirtschaft nicht mehr, ganz im Gegenteil. Wenn man Mindestlöhne erhöht, geht dieses Geld eins zu eins in den Konsum, ist also wirklich ein Antriebsfaktor für die Konjunktur, und da klemmt’s ja im Moment, beim Konsum. Es wäre das Vernünftigste, den Menschen Geld zu geben, die es wirklich brauchen und ausgeben, anstatt denen, die es zur Hälfte auf die hohe Kante legen.
Zur Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen braucht es einen »Kulturkampf«, heißt es im Buch. Wie ist das gemeint?
Das neoliberale Menschenbild, dieser Homo oeconomicus, ist ja ungeheuer menschenfeindlich: Der Mensch ist von Natur aus faul und tut überhaupt nichts, wenn er persönlich keinen Vorteil davon hat. Darauf fußt das Armenbashing und die Sanktionierung armer Menschen in Hartz IV. Als es darum ging, die Sanktionen vielleicht abzuschaffen, die Grünen hatten das in die Ampel reingetragen, ist mir klargeworden: Hier geht’s gar nicht nur um sachliche Politik. Es wird kaum jemand sanktioniert, vollsanktioniert schon gar nicht, nur ein paar arme Menschen, die ihre Termine verschusseln, von ihrem Alltag überfordert sind und Hilfe bräuchten, aber bestimmt keine Sanktionen. Verhaltensänderungen bewirkt der Überwachungsmechanismus bei denen, die sanktioniert werden, in der Regel auch nicht. Also: Was soll der Quatsch? Weg damit! Aber statt dieser Einigkeit in der Sache entbrannte eine Debatte über Leistungsbereitschaft. Die fleißige Mittelschicht wurde in Stellung gebracht gegen angebliche Faulpelze. Da wurde mir klar: Hier geht’s um mehr als Sozialpolitik. Das ist etwas, was einem Kulturkampf gleichkommt: Wie gehen wir mit Hilfebedürftigen um? Wir tun uns unglaublich schwer, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen.
Im Buch vergleichen Sie das mit der Prügelstrafe in der Schule.
In meiner Kindheit wurde die noch praktiziert. Viele im Lehrkörper haben damals gesagt: Wir brauchen die Möglichkeit dieser Prügelstrafe, sonst kriegen wir keine Disziplin in den Klassenverband und können nicht bilden. Die gleiche Argumentationsschiene haben wir heute bei den Jobcentern: Wenn wir nicht sanktionieren dürfen, kommt keiner mehr. Dann hätten wir sozusagen ein bedingungsloses Grundeinkommen und nach neoliberalem Menschenbild arbeitet dann keiner mehr. Es hat sich in der Schule gezeigt: völliger Irrtum. Wir haben die Prügelstrafe verboten, und unser Schulsystem hat sich darauf besinnen müssen, attraktiven Unterricht zu machen, der nicht über Sanktionierung funktioniert, sondern Schüler abholt, wo sie sind.
Nun geht aber seit Jahrzehnten alles rückwärts. Wird bald die Wiedereinführung der Prügelstrafe gefordert?
Wir haben einen Rollback in vielen Bereichen, das stimmt, aber Körperverletzung wieder hoffähig zu machen, wird nicht gelingen. Wir werden auch das Prügeln in der Familie nicht mehr erlauben und die Kindesmisshandlung. Ich glaube, da kann ich Sie beruhigen. (lacht)
Könnte zu dem Kulturkampf gehören, den Begriff Clankriminalität auf die Quandts anzuwenden?
Das spricht unsere Tugendskala an, unsere Moral. Auf der einen Seite werden Menschen gebasht, die aufstocken müssen mit Hartz IV, weil sie angeblich faul sind. Auf der anderen Seite tun wir alles, damit unsere Erben, die leistungsfrei riesige Einkommen erzielen, ja nicht zur Kasse gebeten werden. Das ist extrem verlogen. Wir verwechseln Leistung mit Erfolg und Erfolg mit Geld. Diese wirklich folgenschwere Verwechslung führt dazu, dass die armen Menschen moralisch diskreditiert werden. Aus der absolut unsinnigen Logik heraus: Die haben kein Geld, also sind sie nicht erfolgreich, also werden sie keine Leistung erbracht haben. Dass das in erster Linie pure Ideologie ist, soll keinem in den Sinn kommen, denn dann hätten unsere Milliardäre, die ihre Riesenvermögen im wesentlichen auf Erbschaften aufgebaut haben, moralisch die schlechteren Karten.
Sehen Sie in der Parteienlandschaft Ansätze für eine Politik der Umverteilung nach unten, die den Rechten das Wasser abgräbt?
Wir haben im Moment keine parteipolitisch denkbare Konstellation, die eine solche Politik umsetzen würde. Das ist leider so. Wir haben nicht die Mehrheitsverhältnisse. Mit anderen Worten: Wir werden auch in den nächsten Jahren weiter ganz, ganz dicke Bretter bohren müssen. Aber was ist die Alternative? Auswandern will ich nicht, und klein beigeben will ich auch nicht. Deshalb bleibt nur der Kampf.
Ulrich Schneider, geboren 1958 in Oberhausen, kam 1988 als promovierter Pädagoge zum Paritätischen Wohlfahrtsverband, wurde dort zunächst DDR-Beauftragter, 1999 dann Hauptgeschäftsführer. Von 2016 bis 2022 war er Mitglied der Partei Die Linke.
Ulrich Schneider hat schon einige Bücher über Sozialpolitik geschrieben, das neue heißt »Krise: Das Versagen einer Republik«, erscheint am kommenden Montag im Westend-Verlag, Frankfurt am Main, hat 176 Seiten und kostet 20 Euro.
Geplant sind bisher zwei Buchvorstellungen in Berlin: 26.6., 12.30 Uhr, Sprechsaal, Marienstr. 26 in Mitte mit Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung; 1.7., 19 Uhr, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Straße der Pariser Kommune 8 a, Friedrichshain.
2 Wochen kostenlos testen
Die Grenzen in Europa wurden bereits 1999 durch militärische Gewalt verschoben. Heute wie damals berichtet die Tageszeitung junge Welt über Aufrüstung und mediales Kriegsgetrommel. Kriegstüchtigkeit wird zur neuen Normalität erklärt. Nicht mit uns!
Informieren Sie sich durch die junge Welt: Testen Sie für zwei Wochen die gedruckte Zeitung. Sie bekommen sie kostenlos in Ihren Briefkasten. Das Angebot endet automatisch und muss nicht abbestellt werden.
-
Leserbrief von Hans Wiepert aus Berlin (24. Juni 2024 um 17:02 Uhr)Schneider hat sich 25 Jahre lang als Supersozialfunktionär inszeniert. Die Peinlichkeit fehlender Tarifverträge im eigenen Laden ist ja schon genannt worden. Und er hat etwa in der Linken die aggressive Spaltungsnummer gegen Sahra Wagenknecht (und viele andere) vorangetrieben. Gerade wegen solcher Leute gönne ich der Partei den Absturz in den Zwei-Prozent-Gullydeckel von Herzen.
- Antworten
-
Leserbrief von Onlineabonnent/in Manfred Guerth aus Manni Guerth (24. Juni 2024 um 12:23 Uhr)Den Kapitalismus zu verstehen, ist eigentlich ganz einfach. Bertolt Brecht sagte das in einem Satz: »Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.« Das bedeutet, dass der Kapitalismus sich von Armut ernährt und gar kein Interesse hat, die Armut zu beseitigen. Das jahrzehntelange Gerede von der Beseitigung der Armut ist nur leeres Geschwätz. Man benötigt keine bücherfüllende Erklärungen und theoretische Selbstdarstellungen, um den Kern des Kapitalismus verständlich zu machen. Mittels der Ausbeutung der Arbeitskraft entsteht Mehrwert. Durch die Aneignung des Mehrwertes wird der Kapitalist reich und der Mehrwertproduzent, der Arbeiter, bleibt arm – weil er nur einen winzigen Teil des Mehrwertes bekommt. Das ist die Realität. Darum kann eine ernsthafte und glaubhafte Debatte um die Beseitigung von Armut nur im Zusammenhang mit der Beseitigung des Kapitalismus bzw. Imperialismus geführt werden. Alles andere ist Placebo. Manni Guerth
- Antworten
-
Leserbrief von Istvan Hidy aus Stuttgart (24. Juni 2024 um 11:36 Uhr)In einer Welt, in der die Kluft zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, stellt sich die Frage: Warum schafft es keine Bewegung, die Situation der Armen grundlegend zu verbessern? Ein wesentlicher Grund ist die systematische Verteilung der Ressourcen – Hilfsgelder fließen oft an die, die sie am wenigsten benötigen. Steuervergünstigungen, Subventionen und Wohngeld kommen den Wohlhabenden zugute, während die Bedürftigsten im Prinzip leer ausgehen. Zudem sind die Kräfte, die sich für die Armen einsetzen sollten, oft zersplittert und uneinig. Linke Parteien und Sozialverbände streiten sich um Details und verpassen das große Ganze. Gewerkschaften verfolgen nur eigene Ziele, die meistens nicht im Einklang mit den Interessen der ärmsten Bevölkerungsschichten stehen, wie die prozentualen Gehaltserhöhungen. Diejenigen, die am dringendsten Hilfe brauchen, haben oft nicht die Mittel oder die Energie, sich politisch zu engagieren. Wer ums Überleben kämpft, kann sich schwerlich für gesellschaftliche Veränderungen einsetzen. Es bräuchte eine starke, geeinte Bewegung, die klar und pragmatisch agiert. Solange diese fehlt und die politische Landschaft nicht bereit ist, echte Umverteilung und soziale Gerechtigkeit zu fördern, bleibt die Bewegung für die Armen ein unerfülltes Versprechen.
- Antworten
-
Leserbrief von Onlineabonnent/in Thomas Königshofen aus Neuss (24. Juni 2024 um 05:53 Uhr)Schneider leistet sich im Interview einen eklatanten Widerspruch. Einerseits geißelt er zu Recht den Nationalismus von Sahra Wagenknecht und lobt andererseits den gerechten Befreiungskampf des ukrainischen Volkes: »Sahra Wagenknecht und ihre Gefolgschaft betreiben eine zutiefst nationale, fast nationalistische Politik, wo die deutschen Interessen auf einmal wieder ganz vorne stehen. Das ist nicht meine Auffassung von linker Politik. Meine Solidarität endet nicht an den deutschen Grenzen. Und sie schließt das ukrainische Volk mit ein, das sich dem Aggressor nicht ergeben will.« Ist die mörderische Inanspruchnahme der ukrainischen Bevölkerung für ukrainische Staatszwecke nicht die höchste Form des Nationalismus?
- Antworten
-
Leserbrief von Onlineabonnent/in Henry Freyer-Steyer aus Berlin (22. Juni 2024 um 14:42 Uhr)Das sind die Linken, wegen denen ich nicht mehr die Linke wähle! Es hört nicht beim ukrainischen Volk auf? Heh, wo waren Sie seit 2014? Wo war Ihre Unterstützung für die Teile des ukrainischen Volkes, die den Putsch in Kiew nicht mitmachen wollten? Wo waren Sie, als die faschistischen Asow-Truppen über Mariupol herfielen im Jahre 2014? Wo waren Sie am 2.5.2014, als im Gewerkschaftshaus in Odessa gemordet wurde? Wo waren Sie, als Tausende Zivilisten, als unschuldige Kinder ermordet wurden? Besuchen Sie die Allee der Engel und fragen diese Kinder, wer hier der Aggressor ist! Selenskij wurde gewählt, weil er Frieden versprach. Fragen Sie doch mal diese Teile des ukrainischen Volkes, ob sie diesen Wahlbetrüger noch mal wählen würden? Sie mögen ja viel Gutes getan haben, aber hier scheint Ihr Blick vernebelt zu sein!
- Antworten
-
Leserbrief von Onlineabonnent/in Steffen Leuschke aus Berlin (22. Juni 2024 um 09:31 Uhr)Warum gelingt es Schneider nicht, endlich mal zuzugeben, dass auch der Paritäter sich wie ein Arbeitgeberverband verhält? Warum sagt er nichts zu den Tarifverträgen, die NICHT abgeschlossen werden bei den Freien Trägern, weil der Paritäter es so will? Warum sagt er nichts zu den Betriebsvereinbarungen, die gerade mal das Mindestmaß an Lohnstrukturen des TV-L oder TVöD abbilden und nicht die Möglichkeiten der Tarifverträge nutzen DÜRFEN? Freie Träger, die im Paritäter organisiert sind, sind immer wieder Bremser gewesen – mit Unterstützung des Paritäter. Der Paritäter hat sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, wenn es um die Interessen der Angestellten ihrer Mitgliederorganisationen geht ... Ein ehemaliger Betriebsratsvorsitzender eines Freien Trägers. Steffen Leuschke
- Antworten
Ähnliche:
 Stefan Boness/IPON07.08.2023
Stefan Boness/IPON07.08.2023Neuer Streit um Mindestlohn
 Jan Woitas/dpa27.06.2023
Jan Woitas/dpa27.06.2023Armut per Gesetz
 Luca Bruno/AP/dpa24.01.2022
Luca Bruno/AP/dpa24.01.2022Trotz Arbeit arm
Mehr aus: Wochenendbeilage
-
Kapital und Barbarei
vom 22.06.2024 -
Strukturelle CDU-PR
vom 22.06.2024 -
Der stille Tod der Seefahrer
vom 22.06.2024 -
Ein Lied für Grand Hotel Europa
vom 22.06.2024 -
Regenbogenforelle
vom 22.06.2024 -
Kreuzworträtsel
vom 22.06.2024