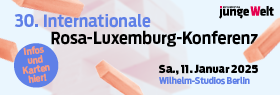Liberalität und Emanzipation
Warum sich die Lektüre der Romane und Novellen E. Marlitts lohnt: Anlässlich des 150. Jahrestags der Veröffentlichung ihres Romans »Die zweite Frau«
Arnd BeiseOb es einem behage oder nicht, »das Factum« bleibe: »Die Frauen sind eine Macht in unserer Literatur geworden«, so der Literaturkritiker Robert Prutz 1859 in seiner Bestandsaufnahme zur »Deutschen Literatur der Gegenwart. 1848 bis 1858«. Im Gegensatz zu früher sei auffällig, dass »die Frauen sich (…) nicht mehr begnügen, bloß in den Bahnen fortzuwandeln, welche die Männer ihnen vorgezeichnet haben, sondern daß sie (…) selbständig aufzutreten und ihre eigenen Interes...
Artikel-Länge: 22313 Zeichen
Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.
Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.
Dein Abo zählt!
Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.
Abo abschließen
Gedruckt
Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.
Verschenken
Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.