Russlands Hilfe
Von Iris Berndt und Hartmut Sommerschuh
Wem es wirklich um Frieden geht, der sollte innehalten und sich erinnern. Vor allem auch in Deutschland. Seine »Kriegstüchtigkeit« löschte ganze Generationen und Epochen des Miteinanders. Sankt Petersburg, einst Leningrad, steht dafür exemplarisch.
Als am 23. Dezember 1941 die Wehrmacht 25 Kilometer vor der Stadt Schloss Peterhof besetzte, den schönsten Sommersitz der Zaren am Finnischen Meerbusen, ging es um Eroberung und Vernichtung. Niemanden interessierte es, dass hier einst ein junges Paar Gemälde und Zeichnungen von Caspar David Friedrich gesammelt hatte. Und dessen Kunst nur deshalb nach der Oktoberrevolution ein Schatz der Eremitage wurde. Soldaten der Heeresgruppe Nord zogen Panzergräben durch die Parkanlagen, fällten alte Bäume zwischen den großen Wasserkaskaden, bauten mit Stacheldraht das »russische Versailles« zu einem Stützpunkt aus. Als sie am 19. Januar 1944 abzogen, waren durch die von Hitler befohlene Blockade in 872 Tagen über eine Million Leningrader verhungert oder erfroren, die Schlossanlagen zerstört und ausgeraubt. Gelöscht war in den Köpfen, wie jetzt wieder durch den Ukraine-Krieg, die jahrhundertelange deutsch-russische Kulturgeschichte.
Die verschwiegene Schau
Zum 250. Geburtstag des beliebtesten deutschen Landschaftsmalers Caspar David Friedrich gab es deutschlandweit Ausstellungen mit Besucherrekorden – in Hamburg, Berlin, Dresden, Schweinfurt, Weimar, Kassel – und natürlich in seiner Geburtsstadt Greifswald. Aber kein Museum, keine Stadt, kein öffentlich-rechtliches Medium hatte den Mut, die am 8. Dezember 2024 eröffnete Ausstellung in Sankt Petersburg zu erwähnen. Und warum es hier die größte Sammlung an Werken Caspar David Friedrichs außerhalb von Deutschland gibt. Nun ist die würdevolle Schau vorbei und es bleibt, wenigstens zu beschreiben, was uns entgangen ist.
Wer in der Staatlichen Eremitage, dem Palastgelände der UNESCO-Welterbestadt, mit Winterpalais, 350 Sälen und einer der weltgrößten Kunstsammlungen, den großen Nikolajewski-Saal betrat, wurde verzaubert. Der international erfahrene Gestalter Maxim Atajanz hatte alles in edles blaues Licht getaucht, auch die Ausstellungswände. Blau ist die Farbe der Romantik. Der weiße Stuckmarmor mit hohen Halbsäulen des einst für Feste und Zeremonien genutzten Raumes trat ins Dunkel zurück. Andächtige Symmetrie prägte die Raumgestaltung. Sie war auch das Grundprinzip Caspar David Friedrichs und gibt seinen Gemälden die Andacht. Zwischen den aufgehängten Bildern war viel Platz. Der Betrachter konnte in Ruhe spüren, dass es innerlich empfundene Landschaften sind, dass jedes Detail eine Bedeutung hat.
Benannt ist der Saal nach dem Zaren Nikolaus I. Pawlowitsch, der – damals noch Großfürst – Ehemann der deutschen Prinzessin Charlotte von Preußen wurde. Sie war das dritte Kind von Friedrich Wilhelm III., geboren 1798 im Schloss Charlottenburg. Zwischen Charlotte und ihm fand schon 1806 eine erste Begegnung statt, als Napoleon Berlin besetzt und sich die deutsche Königsfamilie in Memel (heute Klaipėda) unter den Schutz von Zar Alexander I. begeben hatte, dem ältesten Bruder von Nikolaus. Da war sie gerade acht Jahre alt. Nach dem Rückzug Napoleons aus Moskau 1812 wechselten die preußischen Truppen, die den Franzosen gedient hatten, auf Russlands Seite. Als die Völkerschlacht vorbei war, festigte sich die Verbindung zwischen dem Zaren- und dem preußischen Königshaus. Im Herbst 1814 besuchten Nikolaus und sein Bruder während ihrer »Grand Tour« durch Europa auch Berlin.
Hier verhandelte man über eine Hochzeit mit Charlotte und besuchte die im Oktober begonnene Akademieausstellung, auf der Caspar David Friedrich drei Bilder zeigte: »Eine stürmische See mit Mondbeleuchtung«, »Ein beschneiter Tannenwald« und »Ein Wald, im Vordergrund zwei große Birken«.¹
Beim nächsten Besuch im November 1815 beschloss man die Verlobung von Nikolaus Pawlowitsch mit der inzwischen 17jährigen Charlotte und damit die Stärkung der politischen Union Russlands mit Preußen. Im Juni 1817 zog sie mit ihrem älteren Bruder nach Sankt Petersburg, wurde verlobt, an ihrem Geburtstag sechs Tage später mit Nikolaus im Winterpalais verheiratet. Nach ihrem Übertritt zur russisch-orthodoxen Kirche bekam sie als Großfürstin den Namen Alexandra Fjodorowna.
Fern von Machtambitionen und tatsächlich verliebt, konnten beide nicht ahnen, dass Nikolaus durch den frühen Tod seines Bruders Alexander I. im Dezember 1825 völlig überstürzt Nachfolger auf dem Zarenstuhl und bald ein brutaler Despot werden sollte. Dass er Offiziere, die gegen diesen spontanen Wechsel, gegen Leibeigenschaft, Zensur und Polizeigewalt im Dekabristenaufstand protestierten, hinrichten oder verbannen lassen würde.
Charlotte war nun eine von sechs aus Deutschland stammenden Zarinnen. Sie hatte Feinfühligkeit und großes Interesse an Kunst mit in die Ehe gebracht. Denn in Berlin war sie mit den Gemälden Caspar David Friedrichs aufgewachsen, die ihr Vater Friedrich Wilhelm III. und ihr älterer Bruder fürs Berliner Schloss gekauft hatten. In jenen Jahren, als der romantische Maler aus Protest gegen Sachsens Bündnis mit Napoleon in Dresden nicht ausstellen wollte.
Weil Charlotte den Prunk pompöser Paläste, auch den des Petersburger Anitschkow-Palais, der Kaiserresidenz, beklemmend fand, ließ Nikolaus I. ihr vom schottischen Architekten Adam Menelaws ein »ländliches Haus« bauen, nicht weit vom großen Peterhof-Palast, ganz im Geiste englischer Landvillen mit romantisierenden gotischen Elementen. 1829 war der »Cottage-Palast« als Sommersitz der Familie fertig. Bei der Belagerung nach 1941 ebenfalls zerstört, wurde er restauriert und ist heute ein beliebter Ort für Konzerte.
Freund und Helfer
Den Eingangsbereich der Caspar-David-Friedrich-Ausstellung in der Eremitage bildete ein einst aus Paris geschenkter Rundtempel mit goldener Kuppel. Hier stieß der Besucher auf Charlottes Russischlehrer. Es war der dafür bei Hofe angestellte Schriftsteller und Übersetzer Wassili Andrejewitsch Schukowski. Er wurde einer der innigsten Freunde Friedrichs. Seine selbstlose Hilfe für den deutschen Maler und seine Wirkung auf die Romantik in Russland waren der überraschende Schwerpunkt der Ausstellung.
Als Sohn eines Gutsbesitzers und eines leibeigenen türkischen Mädchens zeichnete Schukowski mit sechs ebenso leidenschaftlich, schrieb mit zwölf sein erstes Melodrama und träumte wie Friedrich in stillen Stunden von Bildern mit Mond und Natur, begleitet von Musik. Schukowski sprach fließend Englisch, Französisch, Deutsch, korrespondierte mit Goethe, dem Weimarer Kanzler von Müller, Alexander von Humboldt, Karl August Varnhagen von Ense, Karl Johann von Seydlitz.² Er wurde ein weitgereister Schriftsteller und Staatsmann und als feinfühliger Übersetzer deutscher und englischer Lyrik wichtigster Pionier der Romantik in Russland.
Caspar David Friedrichs Art, lange gereifte innere Bilder in Malerei umzusetzen, aber auch sein Verhältnis zu Schukowski führten zum Titel der Ausstellung: »Landschaft der Seele«. Die Kokuratorin Alexandra Konschakowa und Michail Dedinkin, Leiter der Abteilung Westeuropäische Kunst an der Eremitage, hatten schon 2020 mit den Vorbereitungen für die Jubiläumsausstellung begonnen. 2021 existierte noch eine Kooperation mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, aber Corona beendete diese. Dann kam der Krieg. Trotzdem wurde entschieden, eine für die Kunst wichtige deutsch-russische Freundschaftsgeschichte in den Mittelpunkt zu stellen.
Als 1820 Charlottes drittes Kind tot geboren wurde, sehnte sie sich erschöpft nach Deutschland, reiste mit ihrem Mann und Wassili Schukowski zum Vater nach Berlin. Es war die Zeit, als das Interesse Friedrich Wilhelms III. an Caspar David Friedrichs »gestrigen« Bildern nachließ, in Russland aber modernere Malerei noch nicht gefragt war. Schukowskis Tagebüchern zufolge weilten sie am 9. November 1820 im Berliner Kronprinzenpalais, wo Charlotte mit ihrem Vater, den Geschwistern und der früh verstorbenen Mutter, Königin Luise, gelebt hatte. Hier besichtigten sie unter anderem die heute so berühmten und früh erworbenen Hauptwerke von Friedrich: »Mönch am Meer«, »Abtei im Eichwald«, »Morgen im Riesengebirge«.
Davon begeistert fuhr Nikolaus auf Bitten Charlottes noch im Dezember 1820 zu Friedrich nach Dresden und kaufte ihm zwei erste Bilder ab: »Die Schwestern auf dem Söller am Hafen« und »Auf dem Segler«.
So verliebt, wie Friedrich zwei Jahre zuvor das Paar auf dem Schiff gemalt hatte – vielleicht sich selbst mit seiner Frau Caroline Bommer darstellend –, so still war er, als Großfürst Nikolaus in sein Atelier trat. Im Frühjahr hatte ein Räuber in Loschwitz seinen Freund und Lehrer, den Porträtmaler und Dresdener Professor Gerhard von Kügelgen, mit einem Beil erschlagen. Von Kügelgen war nicht nur Mitglied der Königlich Preußischen Akademie gewesen, sondern auch der Kaiserlich Russischen Akademie der Künste in Sankt Petersburg. Ergriffen von Friedrichs Niedergeschlagenheit, versprach Nikolaus: »Friedrich, wenn du in Not kommst, lass es mich wissen, ich werde dir helfen.«
Die beiden damals erworbenen Bilder eröffneten die Ausstellung in der Eremitage. Auf den blauen Ausstellungswänden ging es chronologisch geordnet in die Tiefe des Raumes. Die Rückseiten der gestaffelten Wände waren den Sepiablättern von Caspar David Friedrich und seinen Aquarellen gewidmet.
Elf Gemälde und 17 Zeichnungen befinden sich heute in russischen Museen, es sind überwiegend Spätwerke. Etwa eine ältere Fassung der auch in Frankfurt am Main aufbewahrten »Schwäne im Schilf« oder das bekannte Bild mit einem Motiv der Klosterruine Oybin: »Der Träumer«.
Fast alles aus den Beständen war ausgestellt, auch die beiden größten und wie Gegenstücke aufzufassenden Bilder »Mondaufgang am Meer« und »Morgen im Gebirge«, sowie zwei Gemälde aus den Moskauer Museen. Eines davon zeigte in Rückenfigur Wassili Schukowski und die mit ihm wie mit Friedrich befreundeten Brüder Alexander und Sergej Turgenjew bei zunehmendem Mond auf einer Terrasse am Meer.
Beginn einer Freundschaft
Im Juni 1821 besuchte Schukowski zum ersten Mal Caspar David Friedrich in Dresden und entdeckte in ihm einen Geistesfreund. In einem Brief aus Karlsbad (Karlovy Vary) vom 23. Juni 1821 an seine Elevin Charlotte, die Großfürstin, schildert er die berührende Begegnung: »Der hervorstechende Zug in seinem Gesicht ist Treuherzigkeit, so ist auch sein Charakter (…). Er spricht ohne Beredsamkeit, aber mit lebhaftem und aufrichtigem Gefühl, wenn man seinen Lieblingsgegenstand berührt, die Natur.«³
Friedrich wiederum schrieb Schukowski bei diesem Besuch einen Spruch ins Stammbuch, der als Projektion auch den Eingang der Petersburger Ausstellung schmückte: »Es ist der Mensch dem Menschen nicht als unbedingtes Vorbild seines Nachstrebens gesetzt, sondern das Göttliche, das Unendliche ist sein Ziel. Nach dem Höchsten und Herrlichsten musst du ringen, wenn dir das Schöne zutheil werden soll.«
Es wuchs eine tiefe Lebensfreundschaft zwischen den beiden Männern. Aus ihrem Briefwechsel wird deutlich, wie hilflos der menschenscheue Friedrich oft war, wie schlecht es der Familie in seinen letzten neunzehn Lebensjahren ging. Neben dem befreundeten Berliner Kunsthändler und Verleger Georg Andreas Reimer begann auch Schukowski, Friedrich durch Bildankäufe und persönliche Besuche zu helfen. Am Zarenhof, in Briefen und auch bei anderen russischen Kunden schilderte er dessen Bilder so eindrücklich, dass stets neue gekauft wurden. So lieferte Caspar David Friedrich Jahr für Jahr immer wieder Bilder.
Zeugnisse des Dankes
Zwischen den Säulen der Eingangshalle der Sankt Petersburger Jubiläumsausstellung standen drei sogenannte »Transparentbilder«. Sie erzählten auch von Friedrichs kindlicher Dankbarkeit für die stetige Hilfe aus Russland. Im Dezember 1830 hatte er Schukowski eine größere Kiste mit sechs Ölgemälden und vier solchen doppelseitig bemalten Bildern angekündigt. Und Ratschläge mitgeschickt, gegen den Staub nach langem Transport per Schiff und Kutsche: »Hochgeschätzter Herr Staatsrat! (…) Diese Bilder müssen alle von einem Sachkundigen mit einem Schwamm und kaltem Wasser abgewaschen werden und mit einem schwachen Matrixfirnis neu überzogen werden.«
Dann folgen im erhaltenen Brief anrührend genaue Anweisungen für die Transparentbilder und ihre Beleuchtung. Licht von hinten aus einem Loch im dunklen Fenstervorhang und dann durch zwei mit Wasser und Rotwein gefüllte Glaskugeln: »Um die Wirkung zu erhöhen, so diese Bilder zur glücklichen Stunde, im günstigen Fall, dass sie gefielen, machen könnten, so wünschte ich, dass sie nur in Begleitung von Musik gesehen werden.«⁴
Die Geburtsstunde des Kinos in der Romantik! 1835 fand tatsächlich eine Aufführung statt. Aber schon im Dezember 1837, beim Brand des Winterpalais, wurden die Blätter zerstört. Nach überlieferten Entwurfszeichnungen hatten Studenten der Sankt Petersburger Kunstakademie drei dieser Bilder extra für diese Ausstellung rekonstruiert. Musik war hier nicht zu hören. Aber die Vorstellungen des Malers wurden aufgegriffen: Im nachfolgenden Hauptraum der Ausstellung erklang Gustav Mahlers 5. Sinfonie. Mit einem QR-Code ließ sich bei jedem Bild des Künstlers noch eine Extramusik abrufen.
Im Juni 1835 traf Caspar David Friedrich ein Schlaganfall. Seine rechte Hand war gelähmt. Kurz zuvor hatte er sein großes Bild »Erinnerung an das Riesengebirge« gemalt. Es gehört heute ebenfalls der Eremitage und ist eines der wenigen von ihm signierten Bilder. Wassili Schukowski bezahlte dafür Friedrich eine Kur in Teplitz. Er besuchte ihn noch einmal, bevor Friedrich am 7. Mai 1840 starb, und notierte im Tagebuch: »Ein trauriges Wrack, eine traurige Ruine, er weint wie ein Kind.«
Auch nach Friedrichs Tod reagierte Schukowski auf einen verzweifelten Brief der Witwe und bat den Zaren um Geld für die notleidende Familie.
Historischer Tiefgang
Nicht nur die beschriebenen Werke Caspar David Friedrichs, insgesamt 200 Objekte, bereicherten die Ausstellung »Landschaft der Seele – Caspar David Friedrich und Russland« in der Sankt Petersburger Eremitage. Leihgaben aus 15 russischen Museen waren herbeigeholt worden, nicht nur Kunstwerke, auch historische Dinge, Briefe und Dokumente. Alles war an den umlaufenden Wänden des Saales in großer Dichte in thematischen Kabinetten präsentiert und lud ein, mehr zur Geschichte dieser deutsch-russischen Freundschaft und ihrer Zeit zu erfahren.
Auf der einen Seite vom Eingang war Charlotte alias Alexandra Fjodorowna in ihrer Sammlungslust für bildende Kunst zu sehen. Mehr als 500 Gemälde zählte ein am Ende ihres Lebens erstellter Katalog. Darunter waren Motive gemeinsamer Reisen mit ihrem Mann Nikolaus I. Links vom Eingang hing sein Porträt als Großfürst und quasi Hausherr, rechts das berühmte frühe Porträt Schukowskis von Orest Kiprenski (1816) aus der Tretjakow-Galerie.
Auch Wassili Schukowski selbst räumte die Ausstellung viel Platz ein. Als Zeichner, Radierer und sogar als Maler einiger beeindruckender Gouachen. An ihnen wurde deutlich, wie die Begegnung mit Caspar David Friedrich seine Art zu sehen prägte. Seine Zeichnungen waren sicher auch Anregung für Friedrich. Denn der war nie im Hochgebirge. Er malte alles im Atelier.
Einladend waren Möbel zusammengestellt, wie auf einem Bild von Schukowskis »Sonnabendgesellschaft« in dessen Wohnung. Eine Vitrine zeigte einige von Schukowkis Schriften, etwa seine russische Nachdichtung von »Undine«, einer märchenhaften Erzählung des aus einer Hugenottenfamilie stammenden deutschen Frühromantikers Friedrich de la Motte Fouqué.
Verloren und geplündert
Aus Dokumenten und Briefen, auch den in der Ausstellung präsentierten, lässt sich schließen, dass es in den Sankt Petersburger Palästen viel mehr Bilder und Zeichnungen von Caspar David Friedrich gab, als bekannt ist. Zu den besonders schmerzlichen Verlusten gehört auch Schukowskis Privatsammlung von mindestens neun Gemälden und 50 Zeichnungen Friedrichs. Nach einem Bericht seines Freundes Iwan Kirejewski von 1830 und dem – wie die Kuratorin erzählte – erst kürzlich aufgetauchten Testament Schukowkis schmückten sie seine Wohnung im Schepeljow-Haus, einem Teil des Winterpalastes. 1841 hatte er aus gesundheitlichen Gründen seinen Dienst am Zarenhof quittiert und war nach Frankfurt am Main gezogen, wo er an der Übersetzung von Homers »Odyssee« arbeitete.
Was die Ausstellung rücksichtsvoll nicht thematisierte: Nach dem Einmarsch der Wehrmacht 1941 in den Peterhof wie in alle Zarenschlösser sondierten Sonderkommandos des Auswärtigen Amtes und der SS die erbeutete Kunst. Nicht alles hatte in den Monaten zuvor evakuiert werden können. Zudem war vieles bereits von marodierenden deutschen Soldaten gestohlen worden. »Kunstschutzoffizier« Ernstotto Graf zu Solms-Laubach übernahm auch in Peterhof die Aufsicht. Bis zur Einberufung war er Direktor des Historischen Museums in Frankfurt am Main gewesen. Von fünf vollbeladenen Lkw mit den Tafeln des Bernsteinzimmers, Möbeln sowie 300 Gemälden aus den Zarenpalästen berichtete zu Solms in einem Brief an Reinhold von Ungern-Sternberg, den Verbindungsmann zum Deutschen Außenministerium.
Der Bremer Historiker Wolfgang Eichwede untersuchte Ende der 1990er Jahre, welche Wege die erbeuteten Kunstgegenstände genommen hatten.⁵ Er und sein Team vermuteten große Mengen an sowjetischen Kulturgütern nach wie vor in deutschem Privatbesitz. Sowjetische Beutekunst ist bis heute mediales Dauerthema. Der deutsche Kunstraub dagegen wurde vergessen gemacht.
Weglassen, was nicht ins Bild passt. Auch die Hilfe Russlands für Caspar David Friedrich gehört dazu. In allen deutschen Medien herrschte Schweigen über die große Petersburger Ausstellung, kaum ein deutscher Kunsthistoriker hat sie besucht. Doch nicht nur das. Die deutschen Jubiläumsausstellungen 2024 gaben dem Besucher wenig Sehhilfe in historische Zusammenhänge, in die Antriebskräfte, Krisen und inneren Gründe, aus denen heraus Friedrich seine Motive wählte. Gerade hier brachte die Petersburger Ausstellung wichtige Einsichten.
Ihr Besucherecho war überwältigend. Mitunter bildeten sich große Trauben. Denn gezeigt wurden eben nicht nur die Gemälde des Malers, sondern mit vielen überzeugenden Dokumenten auch seine Beziehung zu Russland. Die Kuratoren hatten viel zu tun. Kollegen aus dem ganzen Land kamen, denn noch nie wurde dieser romantische Höhenflug in Russland zwischen 1820 und 1840 so ausführlich erzählt, noch nie waren so viele Zeichnungen Wassili Schukowskis ausgestellt. Eine Abendöffnung an ausgewählten Wochentagen wurde eingerichtet, die eine ruhigere Zwiesprache mit seiner Kunst erlaubte. Die Fülle des Neuen war so groß, dass der Ausstellungskatalog die Planung sprengte. Sein Erscheinen verzögert sich noch bis zum Jahresende.
Deshalb ist dem Münchner Verlag Schirmer/Mosel zu danken: für seine schon 2024 erschienene Neuauflage eines Kataloges der ersten Caspar-David-Friedrich-Ausstellung in den USA. 1990 präsentierte die Kuratorin Sabine Rewald im New Yorker Metropolitan Museums of Art ausschließlich »Gemälde und Zeichnungen aus russischen Museen«.⁶ Neun Gemälde und sechs Zeichnungen kamen damals aus der Staatlichen Eremitage Sankt Petersburg, die Direktorin des Moskauer Puschkin-Museums schickte fünf Zeichnungen.
Philippe de Montebello, von 1977 bis 2008 Direktor des Metropolitan, und James N. Wood, bis 2006 Chef des Art Institute of Chicago, schrieben in ihrem Vorwort: »Unter den vielen Anlässen, die neue Offenheit zwischen den USA und der UdSSR gebührend zu feiern, scheint uns das visionäre Werk des größten deutschen Romantikers besonders angemessen zu sein.«
Anmerkungen
1 Vgl. Helmut Börsch-Supan: Caspar David Friedrich und Berlin. Der Anfang einer Vorgeschichte. In: Berlin in Geschichte und Gegenwart. Jahrbuch des Landesarchivs Berlin (1988), S. 60
2 Vgl. Н. Е Никонова: В. А. Жуковский и его немецкие друзья. новые факты из истории российско-германского межкультурного взаимодействия первой половины XIX в (N. E. Nikonowa: W. A. Schukowski und seine deutschen Freunde. Neue Fakten aus der Geschichte der russisch-deutschen interkulturellen Interaktion in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts). Tomsk 2012
3 Sigrid Hinz (Hg.): Caspar David Friedrich in Briefen und Bekenntnissen. Berlin 1974
4 Caspar David Friedrich: Brief an Schukowski, Dresden, 12.12.1835. In: ebd., S. 68
5 Wolfgang Eichwede, Ulrike Hartung: Einleitung. Krieg gegen die Kultur. In: dies. (Hg.): »Betr.: Sicherstellung«. NS-Kunstraub in der Sowjetunion. Bremen 1998, S. 7–17
6 Sabine Rewald (Hg.): Caspar David Friedrich, Gemälde und Zeichnungen aus russischen Museen. Mit Texten von Sabine Rewald, Robert Rosenblum, Boris I. Aswaritsch. München 2024
Ein Film über die Ausstellung in der Eremitage findet sich unter: https://t1p.de/eremitage
Dr. Iris Berndt ist Kunsthistorikerin und Historikerin. Mehr Informationen unter: www.irisberndt.de. Hartmut Sommerschuh war von November 1989 bis 2016 Redaktionsleiter und Redakteur der Umweltfernsehreihe »Ozon«, die zunächst im Deutschen Fernsehfunk und anschließend im Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg und im RBB ausgestrahlt wurde.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ähnliche:
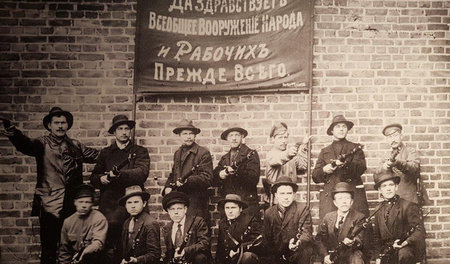 Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst17.04.2018
Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst17.04.2018Hammer und Pflug
 Staatliches Historisches Museum, Moskau25.10.2017
Staatliches Historisches Museum, Moskau25.10.2017Stärkt die rote Welle!
 Museum Des Großen Vaterlaendischen Krieges 1941-194511.07.2017
Museum Des Großen Vaterlaendischen Krieges 1941-194511.07.2017Ohne Gnade
