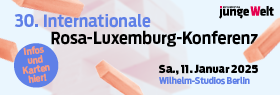Stimmung im Keller
Von Lucas Zeise
Die Deutsche Bundesbank findet, die hiesige Wirtschaft befinde sich in »schwierigem Fahrwasser«. Sebastian Dullien, Chef des gewerkschaftsnahen Wirtschaftsforschungsinstituts IMK in Düsseldorf, stellt fest, die Wachstumsschätzungen der Regierung seien »zu optimistisch«. Da Wirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) und der Sachverständigenrat ohnehin nur auf ein Realwachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in diesem Jahr von allenfalls 0,3 Prozent gehofft hatten, kann das nur bedeuten, dass 2024 wieder ein Rezessionsjahr in Deutschland sein wird. Im August schwenkten die Konjunkturbeobachter mehrheitlich auf Rezession um. Die Institute in Halle und Kiel sprechen unentschlossen von »konjunktureller Abkühlung« (ein anderes Wort für Rezession), das Ifo-Institut in München und das DIW, Berlin, rechnen jetzt beide mit einem BIP-Rückgang um 0,4 Prozent, das RWI in Essen sogar mit minus 0,6 Prozent. Der DIW-Chef Marcel Fratzscher, wohl zu Recht als regierungs- oder besser kanzlernah bezeichnet, mildert die unangenehme Prognose mit der Bemerkung, die Stimmung sei derzeit schlechter als die Lage.
Die Stimmung ist wirklich grottenschlecht. Am 23. September, als Habeck sich mit einigen Autobossen und der IG-Metall-Führung zusammenschaltete (um zu beraten, wie der Staat mit neuen Subventionen den Absatz von Elektroautos fördern könnte), kamen weitere schlechte Konjunkturdaten hinzu: Der sogenannte Einkaufsmanagerindex, der die erwartete Nachfrage bei Industrie und Handel ganz gut widerspiegelt, fiel im September bei den Dienstleistungen von 51,2 auf 50,6, in der Industrie von 42,4 auf unterirdisch niedrige 40,3 Punkte. (50 Punkte stellen dabei die Grenze zwischen Expansion und Rückgang dar.) »Die deutsche Privatwirtschaft ist im September noch tiefer in den rezessiven Bereich abgerutscht und so stark geschrumpft wie seit sieben Monaten nicht mehr«, kommentierte der Verband diese Daten. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel im September von 86,6 Punkten auf 85,4 Punkte. Das wichtige Stimmungsbarometer, für das 9.000 Unternehmen befragt werden, verschlechterte sich damit das vierte Mal hintereinander.
Noch ein Rezessionsjahr
Weil die Weltwirtschaft insgesamt »verhaltener« wächst als in der zweiten Dekade des Jahrhunderts, geht der deutsche Export insgesamt zurück. Da wegen der Kaufkraftverluste der Bevölkerung infolge der Inflation auch der Import zurückgeht, bleibt der traditionell hohe deutsche Außenhandelsüberschuss zunächst erhalten. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW), das von den Industrie- und Arbeitgeberverbänden finanziert wird, berichtet: »Das schlechte Auslandsgeschäft, die anhaltend hohen wirtschaftlichen und politischen Verunsicherungen sowie die hohen Finanzierungskosten belasten die Investitionen stärker als angenommen«. Das Institut rechnet vorsichtig mit einem Rückgang der Anlageinvestitionen in diesem Jahr um die drei Prozent. Sogar die Zahl der Arbeitslosen steigt wieder. Im August waren mit 2,87 Millionen Personen 176.000 mehr Arbeitslose gemeldet als im Vorjahr. Auch positive Nachrichten gibt es indes: Die Inflationsrate ist im August unter zwei Prozent gesunken, was der Zielvorgabe der Europäischen Zentralbank (EZB) entspricht. Die EZB hat, auch weil in der Euro-Zone insgesamt die Inflation – auf 2,2 Prozent – zurückging, ihren Einlagezins zum zweiten Mal – auf »nur« noch 3,5 Prozent – verringert.
An die Erkenntnis, dass Deutschland so kurz nach dem Einbruch durch den Lockdown während der Covid-19-Pandemie wieder in die Rezession gleiten würde, haben sich die Statistiker und Volkswirte mühsam herangeschlichen. Das BIP-Wachstum war im ersten Quartal 2023 mit + 0,1 und dann im zweiten Quartal mit minus 0,1 Prozent angegeben worden. Das dritte Quartal war mit + 0,2 Prozent knapp positiv. Erst das 4. Quartal (minus 0,4 Prozent) zeigte dann, dass 2023 insgesamt ein Rezessionsjahr gewesen war. Der enorme Anstieg der Energiepreise seit Mitte 2021 und der folgende generelle Inflationsschub mit Preissteigerungsraten von bis über zehn Prozent wurden in ihrer konjunkturell enormen Wirkung unterschätzt. Dabei ist die Sache einfach. Wer erst für Heizung, Strom und Benzin und dann in einem zweiten Schub für alle Dinge des täglichen Bedarfs mehr Geld ausgeben muss, hat weniger übrig, um sich andere Dinge zu leisten. Die höheren Lohnabschlüsse seitdem haben die Reallohnverluste nur teilweise wettgemacht, auch weil häufig Einmalzahlungen vereinbart worden waren. Die von der Bundesbank und der Regierung gehegte Hoffnung, der nur zaghaft wachsende Konsum werde sich alsbald beleben, hat sich nun schon zwei Jahre lang als Chimäre erwiesen. Woher sollte denn der Konsumaufschwung jetzt kommen? 2024 wird also, wie die Mehrheit der Prognostiker sich in diesem Sommer durch Zahlen hat überzeugen lassen, das zweite Rezessionsjahr in Folge sein. 2023 war erst das neunte Rezessionsjahr seit 1951, in dem die als BIP gemessene Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorjahr und um den Preisanstieg bereinigt geschrumpft ist.
Minus 0,3 Prozent. Das ist ein relativ geringer Rückgang. Man könnte das eher Stagnation nennen. Zumal seit 2018 das BIP-Wachstum in Deutschland generell kümmerlich (d. h. unter plus ein Prozent) blieb. Allerdings mit der bemerkenswerten Ausnahme der Coronakrise 2020, als es einen administrativ verordneten Einbruch (von minus 8,9 Prozent in einem Quartal und einen Aufschwung von plus 8,6 Prozent im Folgequartal) gab. Rezessionsjahre schließen meist eine Abschwungphase ab. So war das jedenfalls im Zeitraum von 1967 bis 1993, dem ein relativ munterer Aufschwung der Investitionen und der Exporte folgte. Die Erholungsphasen nach Rezessionsjahren wurden allerdings im Lauf der Zeit schwächer. Nach der bei weitem tiefsten Rezession, der von 2009 (minus 5,7 Prozent), die der weltweiten großen Finanzkrise (2007/2008) folgte, war der Aufschwung zunächst zwar auch beachtlich, mündete danach aber in eine stagnationsähnliche Phase schwachen Wachstums.
Schwache Weltkonjunktur
Wenn man über Rezessionen in Deutschland redet, gilt es als selbstverständlich, dass sie in ihrem Verlauf dem Auf und Ab der Konjunktur in anderen Ländern ähneln. Es ist sinnvoll, sie in erster Linie als lokale Erscheinung der Schwankungen des Weltmarktes für Waren und Kapital zu begreifen. Tatsächlich ist der Konjunkturverlauf in den industriell und kapitalistisch hochentwickelten Ländern durchweg ähnlich. Dass die bei weitem größte Volkswirtschaft, die der USA, den Ton angibt, ist auch eine Selbstverständlichkeit.
Die letzte große Weltrezession in den Jahren 2007 bis 2009 beendete (vorläufig) die Phase der sogenannten Politik des Neoliberalismus. Er heißt treffend so, weil er die Freiheit des Kapitals gegenüber den arbeitenden Klassen auf die Spitze treibt, durch Staatseingriffe die Gewerkschaften schwächt, die Lohneinkommen senkt und damit Mehrwert- und Profitrate erhöht. International fördert der Neoliberalismus nicht nur die Freiheit des Warenverkehrs, sondern schleift auch die Schranken des Kapitalverkehrs. Den Staaten bleibt die Rolle, sich als bester und profitabelster Standort zu präsentieren, die Löhne zu drücken, hohe Subventionen bereitzustellen sowie für eine gediegene Infrastruktur zu sorgen. Neoliberalismus heißt drittens, den Finanzsektor (Banken, Versicherungen, Fonds, Börsen) zu fördern, steigende Verschuldung und Spekulation zuzulassen, um über die Aufblähung des nominalen Reichtums (steigende Preise für Grund und Boden sowie Realkapital) den Schwung der Gesamtnachfrage aufrechtzuerhalten. Wie bekannt, ist die so kreierte Finanzblase 2007 dank eines leichten Rückgangs der US-Immobilienpreise und der folgenden Bankenzusammenbrüche geplatzt. Die US-Nachfrage brach ein, weil die Kapitalzufuhr in das besonders hoch verschuldete Land zum Stillstand kam. Das leitete 2008 die scharfe Weltrezession ein.
Den Weg aus der Finanz- und Weltwirtschaftskrise wies eine bis dahin nicht gekannte finanzielle Hilfsaktion der von der Finanzkrise betroffenen Staaten. Sie sicherten die Zahlungsfähigkeit der Banken, übernahmen sie in staatliche Regie, genehmigten Zuschüsse und Garantien für Fonds und Versicherungen, senkten die Zinsen für die Banken auf Nullniveau und füllten schließlich die Lücke in der realen Gesamtnachfrage durch Investitionsprogramme und Kaufprämien. Der Ende 2008 in den USA scharf abgesenkte Leitzins blieb bis 2015 bei null Prozent. Erst dann war der Finanzmarkt wieder so weit erholt, dass der Kredit- und Spekulationsboom wieder zum Selbstläufer wie vor der Finanzkrise geworden war. Dennoch erholte sich die Weltwirtschaft nicht wie zuvor. Die Wachstumsraten blieben in den alten kapitalistischen Ländern nur mäßig. Als Hauptgrund dafür kann man konstatieren: Die kapitalistische Weltwirtschaft befand sich weiter in einem Zustand der Überproduktion und Überakkumulation. Die Krise hatte zwar den Wert des Finanzkapitals etwas eingedampft, aber die Entwertung des fungierenden Kapitals war nicht so weit gegangen, dass ein neuer Zyklus hätte mit Schwung eingeleitet werden können.
Im Gegenteil, die Periode der rentierlichen frischen Anlagemöglichkeiten in vom Kapitalismus unberührten Regionen, die mit der Öffnung Chinas (1978) und der Auflösung des Sozialismus in Russland und Osteuropa (1990) begonnen hatte, neigte sich dem Ende zu. Einige der bisher als Schwellenländer gekennzeichneten Länder (nicht nur China, sondern auch die Tigerstaaten Ostasiens, Russland, Mexiko, Brasilien, Iran oder sogar Indien) wurden zur kapitalistischen Konkurrenz. Zum ersten Mal in der Geschichte der Weltwirtschaft spielte beim Aufschwung nach der Finanzkrise die steigende Nachfrage der Schwellenländer die wichtigste Rolle. China änderte seine Entwicklungsstrategie vom einseitigen Ausbau der Exportwirtschaft auf die Förderung des Binnenmarktes durch Investitionen in die Produktion von hochwertigen Waren und in die Infrastruktur (Verkehrswege, Wohnungsbau, Kommunikation). Der stark steigende chinesische Import von Maschinen machte das Land vorübergehend zum größten Kunden deutscher Exporte.
Die Erholungsperiode seit der Weltwirtschaftskrise 2008/09 dauerte ungewöhnlich lange und war, an den Wachstumsraten des BIP in den alten Industrieländern gemessen, außergewöhnlich schwächlich, weshalb das Wort Aufschwung dafür auch von optimistischen Mainstreamökonomen kaum verwendet wird. Dieser »Aufschwung« endete 2019 fast unbemerkt, als fast überall die Investitionen und der Welthandel erlahmten und sogar in neukapitalistischen Ländern die Wachstumsraten niedriger wurden. Vermutete Ursache damals: Von den USA ging eine Art selektiver Deglobalisierung aus. Sanktionen, Zölle wurden hoffähig, behinderten jedenfalls den Warenverkehr.
Die Coronakrise schlug zu Jahresbeginn 2020 zu. Die Regierungen griffen fast überall zu Einschränkungen, die vor allem den Konsum, dann aber auch die Produktion stark einschränkten. Das war kein sanftes Abgleiten in die Rezession mehr, sondern ein Absturz. Von den Kurseinbrüchen an den Aktienmärkten aufgeschreckt, senkten die Notenbanken die Zinsen auf null Prozent, die Regierungen fuhren, wie 2008/09 geübt, große Rettungsprogramme für Industrie und Banken hoch sowie einige Maßnahmen, um die Bevölkerung nicht ganz verarmen zu lassen. Ökonomisch war die Coronakrise schnell überwunden. Dem Absturz des BIP in Deutschland im Sommerquartal 2020 von fast minus neun Prozent folgte schon im Herbst desselben Jahres eine Erholung in beinahe ähnlicher Größenordnung. Die Hoffnung allerdings, damit die fällige Rezession auch schon überwunden zu haben, erfüllte sich weder in Europa noch in Nordamerika.
Die beginnende Wirtschaftskrise wurde verschärft durch den 2021 einsetzenden Anstieg der Energiepreise, der in eine allgemeine Teuerung, auch Inflation genannt, mündete. Die steigenden Preise für Erdöl und Erdgas waren durch politische Maßnahmen (Sanktionen und Kriege) gegen einige große Förderländer (Venezuela, Irak, Libyen, Iran) verursacht worden. Der intensivierte Wirtschaftskrieg gegen Russland verschlimmerte die Lage im Frühjahr 2022. Energierohstoffe, besonders Rohöl werden in der industriellen Produktion, beim Transport, bei der Stromproduktion und in der Landwirtschaft überall gebraucht. Und sie beanspruchen zum Heizen und Transport große Teile des Budgets der Endkonsumenten. Wenn die Preise für Erdöl und Erdgas kräftig steigen und einige Monate lang hoch bleiben, treibt das die Preise in nahezu allen Bereichen der Wirtschaft (Industrie, Verkehr, Landwirtschaft) und es verteuert auch wichtige Produkte des privaten Verbrauchs (Benzin, Gas, Elektrizität). Die Inflation stieg bis ins Jahr 2023 fast weltweit stark an. Die Notenbanken erhöhten ihre Leitzinsen. Was das Wirtschaftswachstum aber stark dämpfte, war die Inflation selbst. Sie zieht den Menschen das Geld aus der Tasche. Der versuchte Aufschwung nach der Coronakrise wurde so abgewürgt.
Kranker Mann Europas
So weit die Schwierigkeiten der Weltwirtschaft. Dazu kommt, wie allerorten beklagt wird, die besondere Wachstumsschwäche Deutschlands. Selbst im Vergleich mit den anderen Ländern der EU, die auch nicht gerade die schwungvollen, kapitalistischen Zentren darstellen, sind die Zuwachsraten in Deutschland von Quartal zu Quartal mit am niedrigsten. Deutschland ist demnach nicht mehr das »industrial powerhouse«, wie die angelsächsische Presse noch vor wenigen Jahren geschrieben hatte, sondern »Nachzügler«, »Schlusslicht«, »Belastung« für die Nachbarn und der »kranke Mann Europas«.
Dergleichen ist nicht nur Gerede. Die Schwächen des Standorts Deutschland sind auch für die Bewohner des Landes spürbar. Ökonomisch ist das an den tatsächlich zurückgehenden Investitionen erkennbar. Politisch an dem geringer werdenden Jubel darüber, dass in der EU nun deutsch gesprochen werde. Sozial hat sich der Abstand in der Reichtumsverteilung zwischen dem reichsten Zehntel der Bevölkerung und dem ärmsten Zehntel im Vergleich mit den größten Ländern am stärksten ausgeweitet. Die Infrastruktur verfällt, statt besser zu werden. Das Verkehrswesen, insbesondere die Bahn, wird weniger effektiv. Das Bildungswesen verkümmert, und das Gesundheitswesen hält der Belastung einer großen Pandemie nicht stand. Die Kapitalisten und ihre Manager klagen über die hohen Kosten, die die Bürokratie verursacht.
Das letzte Mal, als Deutschland als kranker Mann Europas bezeichnet worden war, fiel mit der Regierungszeit Gerhard Schröders zusammen. Die Weltwirtschaft wurde im Jahr 2000 vom Zusammenbruch der Hyperspekulation in Aktien der sogenannten Dotcom-Blase beeinträchtigt. Zudem war 1999 der Euro als Gemeinschaftswährung der EU, zunächst als Buchgeld, geschaffen worden. Das führte in der Anfangsphase der Währungsunion zu Bewegungen am Kapitalmarkt zu Ungunsten des deutschen Finanzkapitals. Der wichtigste Anreiz für die damaligen Schwachwährungsländer (d. h. solche, deren Währung gegenüber der führenden D-Mark immer wieder abgewertet worden war), am Euro überhaupt teilzunehmen, waren die deutlich verbesserten Finanzierungsbedingungen. Weil mit dem Übergang zum Euro am Kapitalmarkt das Währungsrisiko der Abwertung verschwunden war, ging das Zinsniveau dort dramatisch zurück. Spekulationskapital strömte in diese Länder. Während der Süden der Euro-Zone einen durch Kapitalzufluss angeregten Wirtschaftsboom erlebte, floss umgekehrt Kapital aus Deutschland ab. Hieraus entstand die Mär von der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit deutscher Konzerne. Als Lösung für diese vorübergehende Schwäche ersann die Regierung Schröder die »Agenda 2010« einschließlich der Hartz-Gesetze. Sie hatten das Ziel, die Lohn- und Lohnnebenkosten dauerhaft zu senken. Wie man heute weiß, mit großem Erfolg. Nachdem die Weltwirtschaft, von den USA ausgehend, wieder in Schwung geraten war, profitierte die deutsche Exportwirtschaft von besonders niedrigen Löhnen.
Binnenmarkt beschädigt
Als nach der großen Finanzkrise die Zinsen in den Südländern der Euro-Zone (Italien, Spanien, Portugal, Griechenland etc.) krisenhaft anstiegen, konnte die deutsche Wirtschaft vor Kraft nicht laufen. Die Koalitionsregierungen unter Angela Merkel (CDU) waren nicht willens, die riesigen Ungleichgewichte innerhalb der EU und besonders der Euro-Zone auszugleichen. Schlimmer noch, um die eigene Stärke gegenüber den Partnerländern und Konkurrenten zur Geltung zu bringen, wurde das deutsche Modell der »Schuldenbremse« auf alle diese ausgeweitet. Die Folge war eine dauerhafte Schwächung der EU. Der Vorteil, den sich das deutsche Kapital mit einem hindernisfreien großen und potentiell kaufkräftigen Binnenmarkt geschaffen hatte, hörte auf, tatsächlich einer zu sein.
Der zweite Grund, warum das deutsche Großkapital sich nach eigener Einschätzung in einer Schwächephase befindet, nennt sich Deindustrialisierung. Das eingangs erwähnte Institut der deutschen Wirtschaft (IW) spricht von einer außergewöhnlichen Schwäche der Industrie. Die Produktion liege derzeit um etwa zehn Prozent unter dem Niveau der Periode vor der Coronakrise, ohne dass Zeichen der Erholung zu erkennen seien. Die Autoren einer Studie des Instituts nennen vier Gründe dafür: Erstens natürlich die schwache Weltkonjunktur, zweitens die ungenügenden Investitionen. Drittens beschweren sie sich über die Verunsicherung durch geopolitische Verwerfungen und den »unklaren wirtschaftspolitischen Kurs in Deutschland«. Das sind Alltagsklagen, und es zeigt lediglich, dass auch das Kapital mit dem Wirken der Ampelregierung unzufrieden ist. Der eigentliche Grund für den mittelfristigen Pessimismus der Ökonomen wird unter viertens genannt: Es sind die gestiegenen Energiepreise sowie die dadurch erhöhten Rohstoff- und Materialkosten.
Man wird den Autoren der Studie recht geben müssen. Olaf Scholz› »Zeitenwende« im Februar 2022 beseitigte mit der Eröffnung des Wirtschaftskrieges gegen Russland einen lange bestehenden Wettbewerbsvorteil des deutschen Industriekapitals. Er bestand darin, über relativ billige und stabile Energiezufuhr zu verfügen. Öl ist, nach einem kräftigen Preisanstieg im Gefolge der Sanktionen gegen Russland, mittlerweile – auch wegen der stagnierenden Nachfrage – wieder erheblich billiger geworden. Bei Gas, weil es im Normalfall über Pipelines geliefert wird, treffen die Sanktionen regional unterschiedlich. Gas wird deshalb auf absehbare Zeit auf dem deutschen Markt teurer bleiben als für die Konkurrenz. Da Gas – gerade bei einer auf erneuerbare Energien umgestellte Stromproduktion – auf mittlere Sicht unverzichtbar ist, wird auch der Strompreis höher bleiben als in der Vergangenheit.
Der größte Gasverbraucher in der Bundesrepublik, die BASF, hat ihre Produktion bereits deutlich zurückgefahren. Ganz ähnlich werden Unternehmen mit hohem Energieverbrauch (Metallerzeugung, Metallverarbeitung, Papier, Chemie, Stahl) ihre Kapazitäten weiter herunterfahren oder gleich ganz dichtmachen. Auch die staatliche Förderung der Stahlerzeugung mittels Wasserstoff (Direktreduktion) bei Thyssenkrupp wird einen massiven Produktionsrückgang nicht verhindern. Die drei größten Industriebranchen in Deutschland – Autoproduktion, Chemie und Maschinenbau – sind zum Rückzug verdammt. Das ebenfalls energieintensive Baugewerbe, das in Deutschland im Vergleich zur Stärke der Gesamtwirtschaft schon mehr als zwei Jahrzehnte lang ein kümmerliches Dasein fristet, geht wohl einer weiteren Periode der Schrumpfung entgegen. Deutschland wird deindustrialisiert.
Schöne Dienstleistungsgesellschaft
Alles halb so schlimm, sagen die neoliberal und grün gefärbten Ökonomen. Moderne Volkswirtschaften seien ohnehin und unvermeidbar von schrumpfender Industrie und einem unaufhörlich wachsenden Dienstleistungssektor geprägt. Sie haben insofern recht, als die Statistiken langfristig seit dem Zweiten Weltkrieg einen steigenden Anteil des Dienstleistungssektors am Bruttoinlandsprodukt auf Kosten der Industrie in den weit entwickelten kapitalistischen Ländern zeigen. Deutschland ist hierbei jedoch ein Ausreißer. Laut Weltbank betrug 2022 der Anteil der Industrie am BIP in Frankreich, Britannien und den USA zwischen 17 und 18 Prozent, in Deutschland (und Japan) aber zwischen 27 und 28 Prozent. Die russische Industrie hatte einen noch größeren Anteil am BIP von 33 Prozent, das noch junge kapitalistische China von mehr als 40 Prozent.
In der Hinsicht sind Deutschland und Japan nach Ansicht dieser Denkschule Nachzügler einer ohnehin fälligen Entwicklung zur umfassenden Dienstleistungsgesellschaft. Noch einige Anmerkungen dazu: Dienstleistungen sind auch deshalb der größte Wirtschaftssektor, weil sie sehr unterschiedliche Branchen umfassen, vom Warenhandel über Transport und Kommunikation, Gesundheits- und Bildungswesen, Gaststätten und Friseure, Hausmeisterei und Agenturen bis zu Versicherungen und Banken. Der statistisch wachsende Dienstleistungssektor dürfte also auch von der Tendenz der Industriekonzerne beeinflusst worden sein, manche Dienstleistungen (wie Reinigung, Kantinen, Auslieferung, Reparaturarbeiten und Marketing) auszugliedern. Ganz zu schweigen von der kunstvollen Aufblähung des Finanzsektors.
Mainstreamökonomen stellen außerdem fest, dass die Industrieproduktion der wesentliche Treiber für das Wachstum von Volkswirtschaften bleibt. Das erklärt auch die besondere Sorge, mit der sich die Politik diesem auch nach der klassischen Theorie zentralen Bereich der kapitalistischen Volkswirtschaft und Mehrwertproduktion zuwendet. Dass Deutschland mit dem Wirtschaftskrieg gegen Russland und der dauerhaften Verteuerung der verfügbaren Energie einen großen Schritt in Richtung Deindustrialisierung geht, versetzt deshalb die weiterblickenden Teile der herrschenden Klasse in Panik. Diese Panik ist vollkommen gerechtfertigt.
Lucas Zeise schrieb an dieser Stelle zuletzt am 21. Februar 2024 über Probleme der chinesischen Volkswirtschaft.
Solidarität jetzt!
Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!
-
Leserbrief von Onlineabonnent/in Franz S. (4. Oktober 2024 um 11:44 Uhr)»Dass Deutschland mit dem Wirtschaftskrieg gegen Russland und der dauerhaften Verteuerung der verfügbaren Energie einen großen Schritt in Richtung Deindustrialisierung geht, versetzt deshalb die weiterblickenden Teile der herrschenden Klasse in Panik.« Wenn man davon ausgeht, dass die Regierung nichts anderes als den ideellen Gesamtkapitalisten repräsentiert, gerät also die »herrschende Klasse« durch ihre eigenen Anordnungen in Panik. Wie lässt sich dieses Rätsel erklären? Leider ist da, wo es richtig interessant zu werden beginnt, der Artikel zu Ende. Deshalb lohnt ein Blick in den Artikel »Schadet sich der deutsche Imperialismus selbst?« (KAZ Nr. 382).
-
Leserbrief von Istvan Hidy aus Stuttgart (3. Oktober 2024 um 22:06 Uhr)Entgegen der Ansicht von Herrn Zeise möchte ich die Aufmerksamkeit stärker auf die allgemeine Abhängigkeit des Westens von globalen Lieferketten lenken, insbesondere im Vergleich zu China und Russland. Während China danach strebt, die gesamte Lieferkette in Schlüsselindustrien wie Chipherstellung, Solarenergie, Batterieproduktion und E-Mobilität – vom Rohstoffabbau bis zum Endprodukt – in eigener Hand zu behalten, hat der Westen durch die Auslagerung der Schwerindustrie seine Kontrolle weitgehend eingebüßt. Russland, obwohl durch Sanktionen isoliert, ist gezwungen, eigenständiger zu agieren und sich von äußeren Einflüssen unabhängiger zu machen. Diese Abhängigkeit des Westens führt dazu, dass selbst wichtige militärische Infrastrukturen der seeherrschenden angelsächsischen Weltmächte, wie die Wartung von Kriegsschiffen, aufgrund fehlender Lieferketten vernachlässigt werden müssen. Letztlich zeigt sich, dass Staaten, die ihre Lieferketten nicht selbst kontrollieren, global abhängig und verwundbar werden.
Ähnliche:
 jW01.02.2023
jW01.02.2023Wirtschaft am Abgrund
 Imaginechina-Tuchong/imago images21.12.2022
Imaginechina-Tuchong/imago images21.12.2022Unterwerfen oder entkoppeln
 IMAGO/Political-Moments05.07.2022
IMAGO/Political-Moments05.07.2022Globalisierung als Wirtschaftskrieg