Die Katastrophe von Fukushima
Von Wolfgang Pomrehn
Am frühen Nachmittag des 11. März, in Europa war es noch früh am Morgen, bebte knapp 100 Kilometer vor der japanischen Ostküste nördlich von Tokio der Seeboden. Mit einem Wert von 9 bis 9,1 auf der Erdbebenskala war dieses sogenannte Tōhoku-Beben eines der schwersten je beobachteten. Das Ergebnis war unter anderem ein Tsunami, der mit einer Höhe von bis zu 40 Metern und einer Geschwindigkeit von 700 Kilometern pro Stunde auf die Küste traf. Die gewaltige Wucht zerstörte zahlreiche Küstendörfer und -städte und forderte mehr als 20.000 Opfer.
Auch das unmittelbar an der Küste gelegene AKW Fukushima Daiichi war betroffen, dessen sechs Reaktoren mit Seewasser gekühlt wurden. Aus diesem Grund hatte man das Betriebsgelände eigens vor dem Bau der Anlage abgesenkt, um den Aufwand zum Hochpumpen des Kühlwassers zu vermindern. Auch auf eine Schutzmauer gegen Tsunamis hatte man verzichtet, obwohl diese in der Region eine durchaus bekannte Erscheinung sind.
Die Folgen für das AKW waren verheerend. Die an diesem Ort noch 15 Meter hohe Flutwelle traf mit voller Wucht auf die Reaktorblöcke, von denen vier zu diesem Zeitpunkt in Betrieb waren. In den anderen beiden war die Kettenreaktion gerade zu Wartungszwecken unterbrochen und der Druckbehälter regulär heruntergekühlt. Dadurch blieben sie von dem verschont, was sich nun in den anderen vier Reaktoren abspielte: Zum Teil durch die Überflutung, zum Teil durch die Zerstörung fiel sowohl die reguläre als auch die Notkühlung aus, die für gewöhnlich durch unabhängige Systeme mehrfach abgesichert wird. Das führte dazu, dass sich die Reaktoren immer weiter erhitzten. Denn selbst wenn die Kettenreaktion unterbrochen wird, was nach dem Beben automatisch geschah, werden durch spontane Zerfallsprozesse der radioaktiven Spaltprodukte zunächst noch weiter große Mengen an Energie freigesetzt. Eine Kühlung ist daher unabdingbar.
Doch die fiel nun in drei der vier Reaktoren aus, und in den folgenden Tagen begann das Uran in ihren Reaktorkernen zu schmelzen. Große Mengen radioaktiven Materials wurden durch Wasserstoffexplosionen freigesetzt und verseuchten die Nachbarschaft des AKW. Mehr als 160.000 Menschen wurden evakuiert, und nach offiziellen Angaben starben 2.313 von ihnen im Laufe der Jahre aufgrund der Katastrophe. Etliche von ihnen konnten bis heute nicht zurückkehren, denn viele Orte in der Nachbarschaft der Reaktoren sind bis heute aufgrund der Strahlung unbewohnbar.
Nach der Katastrophe wurden zunächst alle japanischen AKW vom Netz genommen. 14 Reaktoren gingen seitdem nach und nach wieder in Betrieb – meist gegen erhebliche Proteste der betroffenen örtlichen Bevölkerung. 19 stehen seit nunmehr 14 Jahren noch immer still und 27 weitere wurden ganz abgeschaltet. Der Anteil der AKW an der landesweiten Stromversorgung lag 2023 bei 5,55 Prozent; 2010 waren es nach Angaben der Internationalen Atomenergieagentur noch 29,21 Prozent.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ähnliche:
 Jan Scheunert/imago/ZUMA Press12.03.2024
Jan Scheunert/imago/ZUMA Press12.03.2024Keine Macht der Atomlobby!
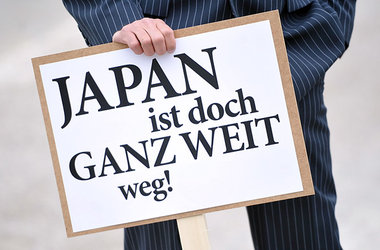 dapd17.03.2012
dapd17.03.2012Unglückliche Umstände
 Reuters10.03.2012
Reuters10.03.2012Alibi »Monsterwelle«
Mehr aus: Schwerpunkt
-
Strahlende Renaissance
vom 11.03.2025

