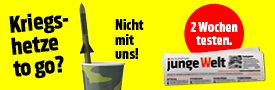Für die Enkel
Von Barbara Eder
Manche Tode sind inverse Geburten – so auch das Ableben der ehemaligen israelischen Ministerpräsidentin Golda Meir in Guy Nattivs Biopic »Golda« (der deutsche Verleih hat den behämmerten Titelzusatz »Israels eiserne Lady« zu verantworten). Es beginnt – gleichsam als Film im Film – mit der Einblendung eines legendär gewordenen Fernsehbeitrags, den die Sterbende kurz vor ihrem Ende sieht. Diese Aufnahme zeigt Meir bei einem Treffen mit dem ägyptischen Staatspräsidenten Anwar Al-Sadat, der verkündet hatte, bis ans Ende der Welt gehen zu wollen, wenn dies den Tod eines einzigen Soldaten verhindern könnte. In der Jerusalemer Knesset angekommen war er am 9. November 1977 auf Einladung des israelischen Ministerpräsidenten Menachem Begin. Für Sadat sollte das Treffen ein Wiedersehen werden. Er wollte es im Beisein der aus dem Amt geschiedenen Politikerin begehen, die die Friedensverhandlungen zwischen Israel und Ägypten wider Willen initiiert hatte.
Nach der Übertragung des Ministertreffens im israelischen Staatsfernsehen verzeichnete die Israel Electric Corporation einen neuen Rekord beim Stromverbrauch. Die Regierungen Syriens, des Iraks, Libyens und Algeriens brachen in Reaktion darauf alle diplomatischen Beziehungen zu Ägypten ab. Auch die palästinensische Nationalbewegung sah den einseitigen Schritt als Verrat. Zwischen Anwar Al-Sadat und Golda Meir war der Funke übergesprungen: Nicht als Politikerin, sondern als »old lady« hatte sie sich an den politischen Partner gewandt. Sie sprach zu einem Großvater, für den die Großmutter Israels noch ein Geschenk übrig habe. Ihre Worte waren symbolisch, der Tausch ein aufgeschobener. Bereits im Kriegsjahr 1967 war Meir davon überzeugt gewesen, dass ihre Enkelkinder Frieden erleben würden. Gemeint waren damit nicht nur die eigenen. Manche blieben freilich ausgespart: »there is no such thing as a distinct Palestinian people«, so Meir.
Zur Übergabe des Geschenks ist es nicht mehr gekommen. Dem letzten Atemzug von Golda Meir (Helen Mirren) folgt eine Kamerafahrt. Zu sehen sind die Schläuche medizinischer Geräte am Boden eines Luftschutzkellers. Währenddessen leiten die ersten Takte eines Liedes zum Abspann über, das ein Geläuterter kurz nach dem Jom-Kippur-Krieg geschrieben hat. Mit »Who by Fire« verfasste Leonard Cohen einen radikal atheistischen Abgesang auf alle Kriege – darunter auch jenen, in den er im Oktober 1973 selbst noch bereit war zu ziehen. An der Sinai-Front sah Cohen Bahren mit Toten und Verletzten. Fortan wollte er nicht mehr mit dem Gewehr, sondern mit der Gitarre kämpfen – und sang vor Ort für Männer, Frauen und Soldaten in den schlimmsten Momenten ihres Lebens.
Eiserne Ladies sterben einsam. Demnach ist die Todesszene in »Golda« auch profan. Die Welt, die Golda Meir den Nachgeborenen hinterließ, ist keine heile, die verlustreiche Bilanz des Jom-Kippur-Krieges ging auch auf ihr Konto. Infolge nachrichtendienstlichen Versagens wurde noch am Morgen des 6. Oktober 1973 von israelischer Seite keine Kriegsgefahr in Betracht gezogen, ein halbes Jahr nach Kriegsende trat Meir zurück. Sie hatte durchgehalten, bis Israel von Ägypten anerkannt wurde. Sadat sprach seither nicht länger von einer zionistischen Entität, sondern von einem souveränen Staat. Für Meir war es zu diesem Zeitpunkt jedoch schon zu spät: Röchelnd und hustend spuckt sie, an Leukämie erkrankt, auf der Hinterbühne immer wieder Blut. Auf der Vorderbühne spricht sie ein mehrköpfiges Männertribunal im Gefolge der Agranat-Kommission vom Versagen im Jom-Kippur-Krieg frei.
Die Frage, ob Gewalt als Mittel und Prinzip zu gerechten Zwecken vertretbar sei, hat Walter Benjamin in »Zur Kritik der Gewalt« (1921) mit Rekurs auf das, was er »göttliche Gewalt« nannte, beantwortet (»… reine Gewalt über alles Leben um des Lebendigen willen«; kein »Maßstab des Urteils«, sondern »Richtschnur des Handelns«). Guy Nattiv reagiert darauf mit seiner, der filmischen Dramaturgie: Auf Meirs Freispruch folgt bei ihm der Tod, auf das Anerkennungsmoment Israels die Versöhnung im Fernsehen. Das Kriegsgericht, vor dem Golda Meir stand, wird damit auch zum Jüngsten, ihr Tod ist nicht rechtens, aber doch gerecht. Meir, so scheint es, hat ihre Zeit gehabt. Durch die Pogromstimmung im Russischen Reich von frühester Kindheit an geprägt (sie wurde 1898 in Kiew geboren), verteidigte sie den israelischen Staat zeitlebens mit Militanz als Bollwerk gegen den Antisemitismus. Ihr Politikmachen kam aus dem agonalen Prinzip und war zugleich Teil ihres eigenen Überlebenskampfes. Meir war bereit, viel zu riskieren – zu viel, wie Nattiv meint. Kurz vor ihrem Tod sieht sie im Film ein letztes Mal zurück – auf sich selbst beim Friedenmachen mit Sadat.
»Golda – Israels eiserne Lady«, Regie: Guy Nattiv, UK/USA, 100 Min., Kinostart: heute
2 Wochen kostenlos testen
Die Grenzen in Europa wurden bereits 1999 durch militärische Gewalt verschoben. Heute wie damals berichtet die Tageszeitung junge Welt über Aufrüstung und mediales Kriegsgetrommel. Kriegstüchtigkeit wird zur neuen Normalität erklärt. Nicht mit uns!
Informieren Sie sich durch die junge Welt: Testen Sie für zwei Wochen die gedruckte Zeitung. Sie bekommen sie kostenlos in Ihren Briefkasten. Das Angebot endet automatisch und muss nicht abbestellt werden.
Ähnliche:
 Hatem Khaled/REUTERS30.05.2024
Hatem Khaled/REUTERS30.05.2024Israel rückt vor, USA sehen weg
 Mohammed Salem/REUTERS25.05.2024
Mohammed Salem/REUTERS25.05.2024Beistand für Rafah
 Allison Bailey/Middle East Images/imago10.05.2024
Allison Bailey/Middle East Images/imago10.05.2024Bidens »rote Linie« für Netanjahu
Mehr aus: Feuilleton
-
Nachschlag: Autonome Androidinnen
vom 30.05.2024 -
Vorschlag
vom 30.05.2024 -
Die kleine Meerjungfrau
vom 30.05.2024 -
Teil einer Jugendbewegung
vom 30.05.2024 -
Wie Macheten, Hämmer und Sicheln
vom 30.05.2024