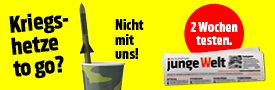Der Tod auf der Straße
Von Martin Küpper
»Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit.« Mit diesen Worten flankierte im Januar 2020 der damalige Bundesinnenminister Horst Seehofer die sogenannte Wohnraumoffensive. Von 2018 bis 2021 wurden 13 Milliarden Euro in die Erhöhung des Wohngeldes, Baukindergeld und den sozialen Wohnungsbau gesteckt. Für die Mieter hat die Offensive wenig gebracht, die Mieten steigen weiter, bezahlbarer Wohnraum ist ein knappes Gut. Für das Heer der Obdachlosen ist die Lage viel schlimmer geworden, sie wurde bei der Wohnpolitik gar nicht berücksichtigt.
Wie viele Menschen allein in Deutschland von dieser krassen Form von Armut betroffen sind, ist nicht bekannt. 2022 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 178.000 untergebrachte wohnungslose Personen gezählt, also Menschen, denen Wohnraum zeitweise durch Institutionen zur Verfügung gestellt wird. Vorher wurden durch die Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung sowie die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe Schätzungen angestellt. Für das Jahr 2018 ging man von 340.000 bis zu 540.000 obdachlosen Menschen aus. Darunter fielen auch diejenigen, die nirgends untergebracht oder akut von Obdachlosigkeit bedroht waren. Jede Nacht sollen 700.000 Menschen in Europa obdachlos sein.
Persönliche Geschichten
Ja, so trocken könnte man in das Thema Obdachlosigkeit einsteigen. Das Buch »Obdachlosigkeit« von Matthias Drilling, Nora Locher, Esther Mühlethaler und Jörg Dittmann wählt einen anderen, besseren Weg. Die vier Forscher haben im Rahmen von Workshops mit ehemaligen Obdachlosen Material gesammelt und so aufbereitet, dass nun ein sprachlich und gestalterisch gelungenes Buch für die breite Öffentlichkeit vorliegt. In 18 Kapiteln werden die Facetten der Obdachlosigkeit vorgestellt.
Die Autoren steigen mit persönlichen Geschichten ein. So geriet Timo in eine Schuldenspirale nach einer gescheiterten Ehe. Die Betreuungskosten für die Kinder stiegen, wegen Mietschulden verlor er seine Wohnung. Der Kontakt zum Nachwuchs wurde schwieriger, weil er sie nirgends empfangen konnte. Nach zeitweilligem »Sofasurfing« landete er in einer Notschlafstelle. Die Situation belastete ihn so sehr, dass er seinen Arbeitspflichten nicht mehr nachkam und ihm gekündigt wurde. Jetzt schläft er im Sommer im Freien und im Winter in einer Notunterkunft.
Die bedrückenden Beispiele zeigen, dass die Anlässe für Obdachlosigkeit vielfältig sind, aber der Grund immer in den gesellschaftlichen Krisen zu suchen ist, deren Lösungen zusehends privatisiert werden. Gerät man in eine Notlage, ist es kompliziert, dort wieder herauszukommen. Wer keine Wohnung hat, findet nur schwer Arbeit, wer keine Arbeit vorweisen kann, hat wiederum kaum Chancen auf eine Wohnung. Scham- und Schuldgefühle, psychische wie körperliche Krankheiten und Gewalt, insbesondere gegen Frauen sowie Trans- und nonbinäre Menschen, erschweren das Ende der Obdachlosigkeit. Die Lebenserwartung von Menschen auf der Straße beträgt 49 Jahre.
Hohe Mieten
Die Autoren plädieren dafür, erfolgreiche Programme wie Housing First auszuweiten. Die Obdachlosen müssen hier nicht beweisen, dass sie »wohnfähig« sind, sie bekommen ohne Wenn und Aber Wohnraum. Denn Wohnen ist ein Menschenrecht. In Österreich, Deutschland und in der Schweiz ist es nicht in die Verfassungen aufgenommen. Die Umsetzung wäre aber ein Hebel, um die Wohnpolitik auf preisgünstiges Wohnen zu verpflichten. Andere Mittel wie Mietendeckel werden genannt, warum sie jedoch in den vergangenen Jahren gescheitert sind, wird nicht analysiert. Auch das grundsätzliche Problem des Wohnens als Ware wird nicht thematisiert. Indem sich die Autoren eher auf das Beschreiben festlegen, liefert das Buch viel Wissen über das Thema, aber nur milde politische Vorschläge. Radikale Wege wie Enteignung oder Mietstreik kommen nicht vor.
Im Abschnitt »Was wir tun können« zeigen die Autoren Möglichkeiten für individuelles Verhalten wie Spenden, Reden oder ehrenamtliches Engagement. In einer Situation wie am Görlitzer Park reichen diese Verhaltensweisen aber nicht aus. Das Elend ist dort omnipräsent und wird von einem ausufernden Drogenkonsum begleitet, dem Einzelne nichts entgegenzusetzen haben.
Die Autoren appellieren deshalb an den Staat, der hier eingreifen müsse. Einerseits sollen Notunterkünfte ausgebaut, billiger Wohnraum niedrigschwellig zur Verfügung gestellt und Zwangsräumungen unterlassen werden. Andererseits – und hier liegt ein Widerspruch, der im Buch nicht aufgelöst wird – liefert der Staat nicht nur die Mittel zur Beseitigung von Obdachlosigkeit. Er ist selbst eine treibende Kraft, indem er zum einen die Privatisierungswellen der letzten Jahre auf dem Wohnmarkt forcierte. Zum anderen haben die Kommunen ein objektives Interesse daran, eher Menschen in die Städte zu locken, die hohe Mieten zahlen können. Sie verdienen daran und bereiten ihnen den Raum mit weicher und harter Verdrängung von Armut, so auch am Görlitzer Park. Dort werden neben Strafverfolgung auch weiche Methoden angewandt. Kürzlich wurde eine Fahrradstraße eröffnet und Sportgeräte aufgestellt. Die Ziele bestanden darin, den Verkehr zu minimieren, die Gegend noch grüner und freundlicher zu machen. Dafür mussten die zahlreichen Tagelöhner vertrieben werden, die dort seit Jahren in Autos und Zelten lebten. Wo sie nun hausen, ist nicht bekannt.
Matthias Drilling, Nora Locher, Esther Mühlethaler, Jörg Dittmann: Obdachlosigkeit. Warum sie mit uns allen zu tun hat. Verlag Scheidegger & Spiess, Zürich 2024, 208 Seiten, 15 Euro
2 Wochen kostenlos testen
Die Grenzen in Europa wurden bereits 1999 durch militärische Gewalt verschoben. Heute wie damals berichtet die Tageszeitung junge Welt über Aufrüstung und mediales Kriegsgetrommel. Kriegstüchtigkeit wird zur neuen Normalität erklärt. Nicht mit uns!
Informieren Sie sich durch die junge Welt: Testen Sie für zwei Wochen die gedruckte Zeitung. Sie bekommen sie kostenlos in Ihren Briefkasten. Das Angebot endet automatisch und muss nicht abbestellt werden.
Mehr aus: Feuilleton
-
Ende gut, alles gut
vom 19.06.2024 -
Rotlicht: Antipädagogik
vom 19.06.2024 -
Nachschlag: Waffen des Diktators
vom 19.06.2024 -
Vorschlag
vom 19.06.2024 -
Veranstaltungen
vom 19.06.2024 -
Schmidt, Woytowicz, Fischer, Koepp
vom 19.06.2024 -
Abrisscrew Pubertät
vom 19.06.2024 -
Schläfrige Schläferzelle
vom 19.06.2024