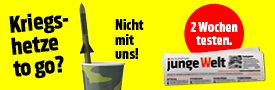»Auflösen, was sich verfestigt hat«
Von Matthias ReicheltIn Ihrer Malerei haben Sie sich auch mit Ihrer Familie beschäftigt, sie hat teils starke autobiographische Züge.
Dass die Biographie in die künstlerische Arbeit einfließen kann, ist kein Geheimnis. Bei mir ist es z. B. die Namensänderung meines Großvaters, der seinen jüdischen Namen Grynszpan wegen des Nationalsozialismus gegen den typisch ukrainischen Namen Kharchenko gewechselt hat, als er in die Rote Armee einberufen wurde.
Ihr Werk besteht aus verschiedenen Gruppen: Sterne-Bilder, Porträts bekannter jüdischer Persönlichkeiten und Gemälde, in denen Sie Auschwitz provokant mit popkulturellen Figuren wie Dagobert Duck, Beavis und Butt-Head oder Superman verknüpfen.
Ja, es sind verschiedene Stränge, und da gibt es auch diese Hausbilder mit fließenden Strukturen. Höhlen, die wie Häuser aussehen, später wurden daraus zeltartige Formen mit herunterfließenden Ölfarben, die auf pastose und lasierende Strukturen treffen und transzendent wirken sowie auch Porträts in der ähnlichen Art.
Ist das Haus ein Schutzraum?
Das kann man als eine Art Schutzraum, eine Hülle sehen. Aber es geht auch um die Möglichkeiten der Malerei. Das ist spirituell und transzendent und etwas ganz anderes als zum Beispiel die neueren Arbeiten zu den Superhelden vor dem Auschwitz- oder Birkenau-Tor oder der Problematik mit der Notwendigkeit, das Barbarische darzustellen und zugleich Phänomene der Kommerzialisierung von Erinnerungskultur zu kritisieren. Mein Werk ist breit angelegt, und ich bin gegen eine Tendenz in der heutigen Kunstwelt, das Sujet wie eine Konsummarke zu reproduzieren. Ich finde das reaktionär und sehe mich ganz und gar nicht in dieser Tradition. Leider befindet sich die Kunstwelt in einem »Konsum-Marken-Fetischismus«.
Ich schaue hier auf Porträts von Fritz Bauer, Paul Celan, Moshe Dayan, Anne Frank, David Ben-Gurion, Franz Kafka und vielen anderen. Sind das Ihre jüdischen Helden?
Ich habe mit dieser als Installation gedachten Serie von universalistischen Juden auf die von Netanjahu und der rechtsradikalen Regierung betriebene Justizreform in Israel reagiert. Und mir die Frage gestellt, mit wem ich mich als Jude überhaupt identifiziere.
Wenn Sie den Universalismus anführen, ist er nicht Teil des Judentums einerseits und andererseits auch eine Auflösung von Religion jeglicher Herkunft, verbunden mit dem Gedanken der Gleichheit aller?
Emmanuel Lévinas hat sich in seiner Philosophie mit der Thora und dem Talmud beschäftigt, hat sich damit aber nicht als Jude in einem »Universalismus« aufgelöst, für mich ist er trotzdem ein universalistischer Denker. Ähnliches gilt für den Psychiater Viktor Frankl, den Philosophen Jacques Derrida und die abstrakten Maler Mark Rothko oder Barnett Newman.
Sei a Mensch …
Ja, gut, das ist auch irgendwie ein Klischee. Was bedeutet »Mensch sein«? Was mich interessiert, ist die Figur des Abraham als Urvater der Juden. Der hat ja nach einem unsichtbaren Gott gesucht, als er seine Familie verließt, die Götzendiener waren. Die Thora oder das Judentum sind stark auf Suche und Debattenkultur ausgerichtet. Es gibt dort keine starre Verfestigung, Gott muss immer erst entdeckt werden. Odysseus ist ein Synonym für Abraham aus meiner Sicht.
Kommen wir zu Ihren Bildern, in denen Sie Auschwitz mit popkulturellen Figuren kombinieren.
Ich stamme aus einer Familie, in der die Großeltern den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, nicht nur als Opfer, sondern auch als Helden. Ich kann mein Leben als ein Wunder betrachten. Für mich werden meine Großväter immer mehr zu Superhelden in meinem Kopf. Beide waren in der Roten Armee und an den schlimmsten Kämpfen von Stalingrad bis Berlin beteiligt. Die haben die Welt von Nazismus und der Diktatur befreit. Dass die überlebt haben, ist ein großes Glück! Und ich bin die Weiterführung dieses Glücks. Zugleich beobachte ich, wie der Holocaust für bestimmte politische Denkmuster in der »Erinnerungskultur« »missbraucht« und »kommerzialisiert« wird. Ich würde diese Worte in Anführungsstrichen setzen, weil Neonazis und Judenhasser behaupten, die Juden würden die Erinnerungskultur nutzen, um davon zu »profitieren«. Ich sehe die dringliche und unabdingbare Notwendigkeit, an den Holocaust zu erinnern und die Deutschen so hart wie möglich mit ihrer Verantwortung zu konfrontieren – wir sehen gerade jetzt, wie offen der Antisemitismus von rechten Biodeutschen und einigen Linken, die sich auf Postkolonialismus und Wokismus beziehen, ausgetragen wird.
Es gibt ja das sarkastische Bonmot »There is no business like Shoah business« …
Ich habe das Bild mit »Jurassic Park« nach Steven Spielbergs Film gemalt, mit einem Dino unter dem Tor mit der Aufschrift »Welcome to Jewish Museum« wie »Arbeit macht frei« in Auschwitz. Theodor Adorno meinte, dass nach Auschwitz kein Gedicht mehr geschrieben werden könne, und hat das später widerrufen, denn man muss das Leid zum Ausdruck bringen. In Claude Lanzmanns Film wird von den Greueln »nur« erzählt, während Steven Spielberg in »Schindlers Liste« eine Gaskammerszene zeigt. Für mich aber bleibt Lanzmanns Methode authentischer. Da aber die meisten Zeitzeugen tot sind und wir wieder in gefährlichen Zeiten leben, ist Lanzmanns Methode nur bedingt möglich, nur anwendbar auf heutige Barbareien. Wie kann man die Unmöglichkeit der Verbildlichung des Holocausts und unserer heutigen Kriege ausdrücken? Ich habe eine pornographische Szene mit dem Schneewittchen und dem Zwerg mit erigiertem riesigen Penis vor Birkenau und blutrotem Sowjetstern gemalt, um die Unvorstellbarkeit des Zivilisationsbruchs und menschlicher Barbarei wie auch den Bruch mit allem, was zivilisatorisch gegolten hat, zu verbildlichen. Damit kritisiere ich auch die Kommerzialisierung des Themas als Blockbuster, aber auch die Verbrechen der UdSSR und des heutigen Russland.
Ich würde gerne noch mal auf Ihren Großvater zurückkommen, den Sie im Superman-Kostüm gemalt haben …
Nicht die US Army hat Auschwitz befreit, sondern die Rote Armee, in der über 700.000 jüdische Soldatinnen und Soldaten gekämpft haben, und viele kamen später als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland, wie auch meine Großväter. Das haben viele vergessen. Die Menschen in der Roten Armee haben unser Leben ermöglicht. Meine säkularen Großväter zeige ich mit blutgetränkten Umhängen als Hinweis auf das Erbe der Sowjetunion und das totalitaristische Regime mit seinen stalinistischen Säuberungen. Der Vater meines Großvaters wurde im Gulag als »Feind des Volkes« erschossen, und die andere Familie von den Nazis umgebracht.
Es gibt Bilder, die nur Sterne zeigen, und dann welche, in denen diese sich fast auflösen, mit dem Hintergrund verschmelzen und nahezu in abstrakte Malerei münden.
Ich wollte die Davidsterne von der dogmatischen Bedeutung lösen. Sie werden oft instrumentalisiert für politische Aussagen und nur auf eine inhaltliche Bedeutung reduziert, sei es Holocausterinnerungen, Religion oder bezogen auf Israel. Sie spielen auch eine große Rolle in der Erinnerungskultur in Deutschland, jedoch oft nur als Aufhänger.
Würden Sie soweit gehen, von Verkitschung zu reden?
Ja, so ähnlich wie mit dem christlichen Kreuz. Da komme ich auch wieder auf den Kunstmarkt zu sprechen. Wenn ich mit meinen Sternbildern Erfolg haben wollte, dann müsste ich schlussendlich Tausende solcher Bilder malen, damit dann alle reichen Kunstsammler von China bis USA diese Bilder besitzen.
Ihre Malerei ist für Sie ein Mittel des Diskurses und der Reflexion?
Auf jeden Fall, und um das, was sich verfestigt hat, aufzulösen, die Betrachter etwas zu verwirren und eigene Sichtweisen zu überprüfen.
Es ist also ein dialektischer Prozess, der bei Ihnen in der Malerei stattfindet?
Ja, ich stelle mich ja selber als Künstler und auch als Mensch in Frage. Ich wachse auch mit den Bildern.
Yury Kharchenko, wurde 1986 in Moskau geboren und wuchs im Rheinland auf. Von 2004 bis 2008 studierte er Malerei bei Markus Lüpertz und Siegfried Anzinger an der Kunstakademie Düsseldorf, seit 2010 lebt er als bildender Künstler in Berlin. Im März illustrierten seine Werke die Literaturbeilage der jungen Welt.
2 Wochen kostenlos testen
Die Grenzen in Europa wurden bereits 1999 durch militärische Gewalt verschoben. Heute wie damals berichtet die Tageszeitung junge Welt über Aufrüstung und mediales Kriegsgetrommel. Kriegstüchtigkeit wird zur neuen Normalität erklärt. Nicht mit uns!
Informieren Sie sich durch die junge Welt: Testen Sie für zwei Wochen die gedruckte Zeitung. Sie bekommen sie kostenlos in Ihren Briefkasten. Das Angebot endet automatisch und muss nicht abbestellt werden.
Ähnliche:
 Martin Moeller/IMAGO/Funke Foto Services29.01.2024
Martin Moeller/IMAGO/Funke Foto Services29.01.2024»Die Regierung verweigert Entschädigungen«
 RIA Novosti archive/Boris Kudoyaro/gemeinfrei27.01.2024
RIA Novosti archive/Boris Kudoyaro/gemeinfrei27.01.2024Mord durch Aushungern
 IMAGO/ZUMA Wire28.10.2023
IMAGO/ZUMA Wire28.10.2023Der Bandera-Kult
Mehr aus: Feuilleton
-
EM-Depesche (6)
vom 21.06.2024 -
Traumhafte Träume
vom 21.06.2024 -
Vorzüge der Virtuosiät
vom 21.06.2024 -
Nachschlag: Angst und Widerstand
vom 21.06.2024 -
Vorschlag
vom 21.06.2024