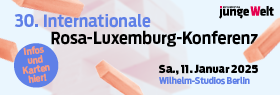Tränen lügen nicht
Von Maximilian Schäffer
»Queer«, geschrieben 1953, erschienen erst 1985, ist William S. Burroughs’ vielleicht traurigstes Buch. Man will dieses Romanfragment »ehrlich« nennen, weil sich der Autor und seine expressiven Drogenvisionen, mit denen er den Großteil seines Werks bestritt, hier selbst entblößen. William Lee, Hauptfigur und Alter ego, hat sich nach Mexiko-Stadt verzogen, dort lebt er unter Expats in feuchten Bars und Stundenhotels. Der junge Adonis Allerton hat es ihm angetan, er fällt in die Kategorie »Boy«. Begehrenswert durch Schönheit und Jugend. Lee verliebt sich hoffnungslos, bezahlt den sexuell ambivalenten Knaben für eine gemeinsame Reise auf der Suche nach der Urwalddroge Ayahuasca/Yagé. Zweimal die Woche muss Allerton sich erbarmen. Gekaufte Zuneigung, die sich bald als die große persönliche Tragödie von Lees Existenz entpuppt. Sein Geschwafel nämlich – die Visionen eines literarischen Genies – ist für das Objekt der Begierde nicht attraktiver als die aufmerksamkeitsheischende Exzentrik eines alten Mannes.
Regisseur Luca Guadagnino zeichnet verantwortlich für die einlullend-sten schwulen Schmachtfetzen der letzten Dekade (»Call Me By Your Name«, »Challengers«). Und verantwortlich für die Entdeckung des schönsten Schmachtknaben Hollywoods – Timothée Chalamet. Nun verantwortet er also die Verfilmung dieses Nichtromans aus einer Zeit, die homosexuelle Begierde gerne mit Päderastie gleichsetze. Die prominenten Schwulen selbst taten ihr Pfündchen dazu; Christopher Isherwood wie Burroughs waren wirklich erwachsene Männer nur wenige Zeilen wert. Burroughs zudem hasste Frauen aus der ihm aufgelasteten Verklemmung heraus. Frauen erscheinen bei ihm durchgehend als Anhängsel oder Gegnerinnen. In »Queer« äußert sich diese Misogynie immer wieder durch Nebenfiguren, die ihre »Weiber« degradieren. Die offen über deren Ermordung phantasieren. Burroughs schoss bekanntlich seiner Ehefrau Joan Vollmer versehentlich nicht den Apfel vom Kopf, sondern die Rübe vom Rumpf.
Im Film, der sich modern an den alten Begriff fürs Schwulsein kuschelt, den er sich aus der vergangenen Zeit leiht, werden harte Widersprüche in der emotionalen Wortwahl sanft ausgespart. Eine Frau, eindeutig Joan Vollmer, taucht für Lee wiederkehrend in Traumsequenzen auf. Als quälende Erinnerung an eine Liebe, die alle Begrifflichkeiten untergraben will. Deswegen nennt er sich nicht »queer«, sondern »disembodied«, körperlos, entleibt. Im Buch hingegen beobachtet Lee am Strand zwölf- bis 14jährige Knaben beim für ihn sehr aufreizenden Spiel. Erst nachdem der alte Mann sich eingesteht, dass sein Verlangen nach jungen, lebendigen Körpern geradezu vampiristische Züge trägt, stellt er fest, dass er mit seinem eigenen Leib nicht umzugehen weiß.
Daniel Craig (56), unter anderem bekannt als James Bond, schwitzt sich gekleidet in Leinenanzügen durch Mittelamerika. An seiner Seite Drew Starkey (31) als der begehrte Eugene Allerton. Beide Hauptdarsteller sind ein Glücksgriff für diesen sexy Märchenfilm, der die gleiche eingelullte Wattiertheit wie »Call Me By Your Name« produziert. Mexiko-Stadt verwandelt sich in computergeschminkten Kulissen pastellfarben in ein anonymes Disneyland. Der Soundtrack von Trent Reznor (Nine Inch Nails) beschränkt sich auf eine Playlist der ambivalenten Eindeutigkeiten: »What else could I say – everyone is gay« – haucht es in Sinead O’Connors Coverversion des Nirvana-Songs »All Apologies« zur Eröffnung über den Bildschirm. Später Tränen in Großaufnahme – dazu New Order.
Guadagnino interessiert sich kaum für Burroughs, kaum fürs Mexiko der 40er Jahre und kaum für Telepathie. Wieder schafft er den perfekten schwulen, superbourgeoisen Schmachtfetzen, der ihm langsam zur Hausmarke wird. Dafür unterstellt er seinen Hauptfiguren so einiges: Eugene sei ganz eigentlich schwul, gestehe es sich aber nicht ein. Lees Suche nach transzendenter Erfahrung sei ein reines Symptom enttäuschter Liebe. Diese eine Liebe war Eugene, und die eine große, naive, pure Liebe (immer wieder will Guadagnino es in jedem seiner Filme ganz eindeutig markieren) sei nicht zu wiederholen.
Treueschwüre und Eheringe beiseite – woher will eine Liebe kommen, die auf Bestechung und Projektion basiert? Guadagnino traut seinen schwulen Abziehbildern nie Tiefe zu, nur immer Geilheit und Ego, und am Ende muss es einsam werden. Richtig ist: Was dieses sogenannte Schwulsein, das heutige »Queersein« war und ist, wusste Burroughs nicht und weiß bis heute auch noch niemand. Am wenigsten der Regisseur. Nimmt man aber den Titel als Begriff genausowenig ernst wie diese 136-Minuten-Leinwandhypnose, dann ist »Queer« tatsächlich ein hervorragender Film.
»Queer«, Regie: Luca Guadagnino, USA/Italien 2024, 136 Min., bereits angelaufen
Solidarität jetzt!
Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!
Ähnliche:
 AP13.08.2010
AP13.08.2010Wütender Klerus
Regio:
Mehr aus: Feuilleton
-
»Erinnerungspolitisch gibt es noch viel zu tun«
vom 03.01.2025 -
Isch bin een Tunt
vom 03.01.2025 -
Silvester
vom 03.01.2025 -
Nachschlag: Projektil
vom 03.01.2025 -
Vorschlag
vom 03.01.2025