Säulenheiliger des Reformismus
Von Ingar Solty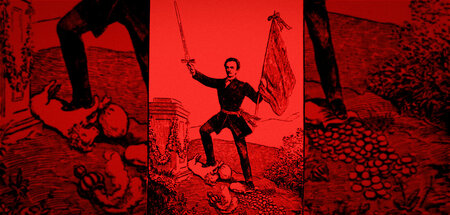
Es ist der 12. März 1864. Preußen und Österreich stehen seit sechs Wochen im Krieg mit Dänemark um die Herzogtümer Schleswig und Holstein. Obwohl er sich in der Schrift »Der italienische Krieg und die Aufgabe Preußens« prinzipiell für den Anschluss Schleswig und Holsteins an Preußen ausgesprochen hatte, steht ein 38jähriger vor dem Staats-Gerichts-Hofe zu Berlin, unter Anklage des Hochverrats: Ferdinand Lassalle.
Der »Hochverraths-Prozeß wider Ferdinand Lassalle«, in dem man ihm Konspiration und Verfassungsfeindlichkeit vorwirft, ist nicht sein erstes Strafgerichtsverfahren. Schon im Februar 1848 ist der schon in jungen Jahren von seinen Mitschülern als äußerst selbstbewusst beschriebene Mann angeklagt, aber dann von den Geschworenen, die er mit seiner Eloquenz beeindruckt hat, freigesprochen worden. Nicht weniger beredt und selbstbewusst zeigt er sich auch am 27. Juni 1864 als Angeklagter vor der »korrektionellen Appellkammer« zu Düsseldorf: »Fünfzig Jahre nach meinem Tode wird man anders denken über diese gewaltige und merkwürdige Kulturbewegung, die ich unter Ihren Augen vollbringe (…), und eine dankbare Nachwelt wird – dessen bin ich sicher – meinem Schatten die Beleidigungen abbitten, welche jenes Urteil und jener Staatsanwalt gegen mich verübt!«
Niemand, auch nicht er selbst, kann zu diesem Zeitpunkt erahnen, dass sein Tod nur noch zwei Monate entfernt ist. Er, dem auch seine späteren Anhänger attestieren werden, »das Persönliche gelegentlich über das Parteiinteresse« zu stellen, stirbt am 31. August in Carouge nahe dem Genfer See in der französischen Schweiz in Folge eines – wie es sein späterer Biograph Gösta von Uexküll nennt – »sinnlosen Pistolenduells um eine wankelmütige Frau«.
Ein Jahr vor seinem Tod hatte Lassalle im Leipziger Pantheon den »Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein« (ADAV) gegründet. 16 Jahre nachdem das deutsche Proletariat in der Revolution von 1848/49 zum ersten Mal als eigenständige Kraft in Erscheinung getreten war, entsteht so auch der erste offizielle politische Zusammenschluss von Arbeitern, die Keimform einer Massenpartei.
Angesichts dieser Leistung wird die Ode verständlich, die Georg Herwegh (1817–1875) in seinem Gedicht »Am Grabe Ferdinand Lassalle’s« auf den ADAV-Gründer verfasste: »An seinem Grabe werden Massen klagen. / Weh’ unsrer Zeit, wenn sie sich’s nicht bewußt, / Daß Nichts ihr tief’re Wunden konnte schlagen, / Als diesen einz’gen Heldenarm’s Verlust! / Das kommende Jahrhundert wird bedauern, / Daß er so früh in’s Nichtsein hingesunken.«
Verräter seiner Klasse
Am 11. April 1825 als Sohn eines zu Wohlstand gekommenen reformjüdischen Kaufmanns in Breslau geboren, wird Ferdinand Lassall, der seinen Namen 1847 in Anlehnung an einen französischen Revolutionsgeneral in die spätere Schreibweise ändert, früh zum Klassenverräter. Schon in jungen Jahren regt sich in ihm ein sozialrevolutionärer Freiheitsgeist. Der pubertierende junge Mann führt seit dem 1. Januar 1840 Tagebuch und beschreibt darin nicht nur libidinöse Sehnsüchte, sondern spricht schon im Alter von 15 Jahren von Deutschland als einem »großen Kerker mit Menschen, deren Rechte von Tyrannen mit Füßen getreten werden«. Als 16jähriger teilt er seinem Vater seinen »unwiderruflichen Entschluß« mit, sich dem »Studium der Geschichte« zu widmen, weil es ihm als das »größte Studium der Welt« erscheint, »das am engsten mit den heiligsten Interessen der Menschheit verknüpft ist«. Rückblickend schreibt der 34jährige Lassalle im Februar 1860 an Karl Marx, er sei schon »seit 1840 Revolutionär, seit 1843 entschiedener Sozialist«.
Nach dem Abschluss des Gymnasiums in Breslau wechselt er zunächst 1840/41 auf die Handelsschule in Leipzig, aber er will nicht in die Fußstapfen des Vaters treten und Kaufmann werden, sondern Schriftsteller und Freiheitskämpfer. Er bricht die Handelsschule ab und lebt wieder – von Mutter und Schwester vor dem Vater versteckt – in der Dachkammer seines Elternhauses. Zwischen 1843 und 1846 studiert er dann in Breslau, Leipzig und Berlin Geschichte, klassische Philologie und Philosophie und begeistert sich für die Ideen von Georg Wilhelm Friedrich Hegel und den Frühsozialisten. Anschließend wird er loser Mitarbeiter der Neuen Rheinischen Zeitung und dadurch auch mit deren Herausgeber Karl Marx und mit Friedrich Engels bekannt. Das im Frühjahr 1848, am Vorabend der Revolution, publizierte »Kommunistische Manifest« von Marx und Engels übt eine magische Wirkung auf ihn aus. Später schwärmt er davon, dass er die Schrift Wort für Wort auswendig gelernt habe.
In der Revolution von 1848 wird der 23jährige Lassalle für den Aufruf zur Steuerverweigerung und revolutionären Bewaffnung verhaftet und angeklagt, bis Anfang 1850 sitzt er im Gefängnis. Für ihn ist dies Glück im Unglück, denn so entgeht er dem Kölner Kommunistenprozess von 1851/52, der die Revolutionäre, die er während der Anklage unterstützt, ins Exil zwingt – auch Marx. Lassalle bleibt als, wie er sich selbst nennt, »letzter Mohikaner« der Revolution in Preußen.
Durch seine anwaltliche Tätigkeit für die zwanzig Jahre ältere Gräfin Sophie von Hatzfeld finanziell unabhängig, kann sich Lassalle, der nach der Freilassung polizeilich überwacht wird, dem Schreiben widmen. So entsteht 1850 seine »Geschichte der sozialen Entwicklung«, als Vorarbeit zu seinem berühmt gewordenen »Arbeiterprogramm« von 1862. Bezüge sind feststellbar zum »Kommunistischen Manifest«, zu Hegel, zu einigen Arbeiten des Rechtshegelianers Lorenz von Stein, von dem auch Marx und Engels das Konzept des Klassenkampfes und sogar die Metapher vom »Gespenst des Kommunismus« entlehnt haben, sowie zu den französischen Frühsozialisten Pierre-Joseph Proudhon, Joseph Fourier und Louis Blanc.
1858 erlangt er ein dauerhaftes Bleiberecht für Berlin. Im selben Jahr entsteht unter anderem das politische Drama »Franz von Sickingen«, das Georg Lukács noch 1948 in den höchsten Tönen loben wird – Lassalle nehme damit eine »einzigartige Stellung in der Entwicklung des modernen Dramas« ein. Im Gegensatz zu anderen Junghegelianern strebt Lassalle aber nicht nur zur Schriftstellerei.
1861 besucht Marx Lassalle für elf Tage in seiner Berliner Wohnung in der am südöstlichen Ende des Tiergartens gelegenen Bellevuestraße 13. Das Treffen zeigt Wirkung: Lassalle drängt es nun zur unmittelbaren politischen Praxis. 1862 beginnt er eine zweijährige Tätigkeit als Agitator unter Arbeitern. Am 12. April, einen Tag nach seinem 37. Geburtstag, hält er eine Rede vor Maschinenbauarbeitern des Handwerkvereins in der Oranienburger Vorstadt, im heutigen Grenzgebiet der Bezirke Mitte und Wedding. Der Vortrag wird noch im selben Jahr als »Arbeiterprogramm« gedruckt. Im Sommer 1862 besucht Lassalle Marx in London und bemüht sich, ihn für sein Projekt zu gewinnen, jedoch erfolglos.
Marx überzeugt das »Arbeiterprogramm« nicht. Er sieht darin, so schreibt er an Engels, eine »schlechte Vulgarisation des ›Manifests‹«. Eduard Bernstein, dessen Revisionismus sich stark auf Lassalle stützt, wird hingegen 1919 über das »Arbeiterprogramm« sagen, es sei »eine vortreffliche Einleitung in die Gedankenwelt des Sozialismus« und »eine der Zeit und den Umständen (…) angepaßte Umschreibung des Kommunistischen Manifests«.
Organisatorischer Vorreiter
Nach dem Besuch bei Marx wagt Lassalle den Alleingang. Angestoßen durch sein »Offenes Antwortschreiben« an das »Komitee der Leipziger Arbeiterzentrale«, das ihn aufgefordert hatte, eine im Geiste der Revolution stehende Programmatik zu verfassen, gründet Lassalle am 23. Mai 1863 den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (ADAV). Lassalle wird, für fünf Jahre gewählt, sein »erster Präsident mit nahezu diktatorischen Vollmachten«. Der ADAV, dessen zentrale Forderungen das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht sowie »Produktivgenossenschaften durch Staatshülfe« – also mit staatlichen Vorzugskrediten angestoßene Genossenschaften in Arbeiterhand – sind, ist neben der sechs Jahre später im Marxschen Geist gegründeten Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) eine von zwei Organisationen, aus denen später die SPD hervorgeht.
Eine entsprechend mythische Figur wird Lassalle, den man sogar als »Erwecker des deutschen Proletariats« bezeichnete, in der Parteigeschichte. Bernstein gibt seine Schriften und auch Korrespondenzen heraus und tut dies im expliziten Bewusstsein der Nützlichkeit des »Kultus der Persönlichkeit«, wie er 1919 in »Ferdinand Lassalle: Eine Würdigung des Lehrers und Kämpfers« schreibt. Im »Roten Wien« mit seinem Gemeindebauvorhaben wird rund um den 100. Geburtstag von Lassalle auch ein »Lassallehof« gebaut. Stellvertretend für viele SPD-Historiker schreibt Helmut Hirsch, der Herausgeber einer Werkauswahl, zum 100. Todestag: »Meteorgleich« sei er »erstrahlt und verglüht innerhalb von knapp vier Jahrzehnten«. Der Lassalleanismus wird eine Kraft, die weit über die Person und vor allem das politisch-theoretisch eher dürftige Werk hinaus ausstrahlt. Insbesondere Lassalles Grundhaltung zum (preußischen) Staat entfaltete ein Eigenleben, das bis heute wirksam geblieben ist.
Idealistische Vorstellungen
Was markiert den Unterschied zwischen Marx und Lassalle, die für zwei gegensätzliche Richtungen in der Arbeiterbewegung stehen? Im Marxismus gilt der Staat als Herrschaftsinstrument der besitzenden Klassen. Der griechisch-französische Marxist Nicos Poulantzas definiert den Staat im Kapitalismus als die »Verdichtung eines Kräfteverhältnisses der Klassen«. Lassalle hingegen übernahm diese materialistische Geschichtsauffassung nie, wenigstens nicht in Bezug auf den Staat, sondern behielt Hegels Auffassung vom Staat als der »Wirklichkeit der sittlichen Idee« bei. Das war durchaus vereinbar mit Lassalles konsequentem Eintreten für die Arbeiterklasse, denn Hegel entwickelt in seiner »Philosophie des Rechts« eine Idee vom Staat, in der dieser in der Fürsorge für die Armen in die Pflicht genommen wird.
Damit steht Lassalle auf einem anderen Boden als Marx. Paul Vogel spricht in Bezug auf Lassalles Staats- und Gesellschaftsauffassung vom »Lassalleschen Marxischen Hegelianismus«. Die Betonung liegt auf Hegel, nicht auf Marx. Verglichen mit letzterem sei Lassalle in erheblichem Maße weniger wissenschaftlich an den Sozialismus herangegangen und weniger an »das eigentliche Gesellschaftsproblem« herangekommen.
Für Hegel besteht Staatskunst darin, die sich in der Gesellschaft entwickelnden Widersprüche in Bahnen der sittlichen Vervollkommnung zu lenken. Der Rechtshegelianer Lorenz von Stein, der in der kapitalistischen Industrieentwicklung den Gegensatz von Kapital und Arbeit und damit das Proletariat als womöglich systemsprengende Kraft erkannte, plädierte entsprechend für ein »soziales Königtum«, das durch weitreichende Sozialreformen von oben der Revolution die Spitze abbricht. Die etablierte monarchisch-obrigkeitsstaatliche Ordnung sollte davor bewahrt werden, durch eine sozialdemokratische Pöbelherrschaft ersetzt zu werden.
Lassalle knüpft an dieses Staatsverständnis an: »Das Lebensprinzip der Geschichte«, argumentiert er, sei »nichts anderes als die Entwicklung der Freiheit«. Entsprechend ambivalent ist Lassalles Revolutionsbegriff. Die Revolution kann sich sowohl auf den Sturz der gegebenen Staatsordnung als auch auf den dialektischen Geschichtsprozess beziehen, der vom Staat in evolutionäre Bahnen gelenkt wird. In »Die Wissenschaft und die Arbeiter« schreibt Lassalle: »Revolution heißt Umwälzung, und eine Revolution ist somit stets dann eingetreten, wenn, gleichviel ob mit oder ohne Gewalt – auf die Mittel kommt es dabei gar nicht an – ein ganz neues Prinzip an die Stelle des bestehenden Zustandes gesetzt wird.« Ein solches »neues Prinzip« können aber auch eine von oben durchgeführte Fabrikgesetzgebung, die Einführung des Normalarbeitstages oder – wie von Lassalle erhofft – die Aufhebung des Gegensatzes von Kapital und Arbeit durch staatlich geförderte Genossenschaften sein. Aus diesem ambivalenten Revolutionsbegriff, der zwischen Reform und Revolution schwankt, ergibt sich der notwendig idealistische Charakter von Lassalles Verständnis vom bürgerlichen Staat – als sei dieser ein neutrales Werkzeug zur Überwindung des Kapitalismus.
Auf Lassalles etatistische Tendenz wird der sozialdemokratische Rechtstheoretiker Hans Kelsen in seinem Werk »Marx oder Lassalle« (1967) hinweisen. Er löst die Frage zugunsten von Lassalle auf: Die »politische Theorie« von Marx und Engels sei mit ihrem »Postulate einer staatsfreien, solidarischen, auf Freiwilligkeit gegründeten Zukunftsgesellschaft (…) reiner Anarchismus« und der marxistische Sozialismus habe aus einer »Mentalität der Oppositionsstellung« heraus niemals erkannt, wie doch der Staat ein »brauchbares Instrument« sein könne, »die Besitzlosen gegen allzu arge Ausbeutung zu schützen«. Lassalle stünde jenseits einer solchen Theorie, die »nur den Klassengegensatz sehen will«, für das »Verständnis für den Staat als Repräsentanten der nationalen Idee, vielleicht der stärksten Kraft, die der Klassenspaltung entgegenwirkt«.
In diesem Sinne eines Sozialismus als nationalem Projekt appelliert Lassalle während seines Hochverratsprozesses auch an die Richter, sie würden ja nicht den »Manchester-Männern an(gehören), jenen modernen Barbaren, welche den Staat hassen«, sondern würden doch dem »Staat überhaupt« angehören, der zu mehr fähig sei. Dabei sieht er im allgemeinen Wahlrecht und der Gründung einer eigenständigen Arbeiterpartei das Mittel, um den Staat quasi als Mehrheit zu übernehmen und über ihn den genossenschaftlichen Sozialismus einzuführen: Dann würde, schreibt er in seinem »Offenen Antwortschreiben« an das Leipziger Arbeiterkomitee, gelten: »Ihre, der ärmeren Klassen große Assoziation – das ist der Staat.«
Nicht durch die Arbeiter
Zu Lassalles Etatismus gehört auch seine These vom »ehernen Lohngesetz«. Sie klingt radikal, weil sie davon ausgeht, dass »der durchschnittliche Arbeitslohn immer auf den notwendigen Lebensunterhalt reduziert bleibt, der in einem Volke gewohnheitsmäßig zur Fristung der Existenz und zur Fortpflanzung erforderlich ist«.
Die Auffassung, dass im Kapitalismus Arbeiter nur das Existenzminimum verdienen könnten, ist eine explizit gegen die Klassenkampftheorie von Marx und zugleich die Tarifautonomie von Gewerkschaften gerichtete Auffassung. Wenn gewerkschaftliche Klassenkämpfe nicht imstande sind, den Lebensstandard der Arbeiter zu heben und diese durch ihre Organisation und den Tarifkonflikt gar nicht selbstwirksam werden, nicht ihre Macht erkennen können, dann bedarf es des Staates, der durch auskömmliche Mindestlöhne das »eherne Lohngesetz« bricht. Das Gesetz mündet also zwangsläufig in eine Politik, die im Staat das Werkzeug der Klassenpolitik erblickt, in eine etatistische Tradition, die vielleicht alles für, aber nicht unbedingt durch die Arbeiter selbst erreichen will.
Aus Lassalles idealistischen Auffassungen ergibt sich auch eine opportunistische Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem preußischen Staat. Während für Marx, Engels und ihre Nachfolger das Ziel in der Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse liegt, hofft Lassalle auf den preußischen Reformwillen, der einen Sozialismus der Genossenschaften schafft. Bernstein wird diese Sozialismusvorstellung und die Hoffnungen auf einen reformwilligen Staat übernehmen. Zugleich ist mit der Vorstellung vom sich sittlich vervollkommnenden Nationalstaat auch ein Stufenmodell der Zivilisationsentwicklung verbunden, das bei Lassalle ebenso wie bei Bernstein eine offene Flanke für die Toleranz oder gar Förderung imperialistischer (Kolonial-)Politik beinhaltet.
Lassalles Bereitschaft, mit dem preußischen Obrigkeitsstaat zusammenzuarbeiten, ist in dieser Zeit auch im ADAV nicht unumstritten. Dem DDR-Historiker Heinz Hümmler und seiner Quellenforschung wird knapp 100 Jahre später das Verdienst zukommen, als erster gezeigt zu haben, welche »revolutionäre proletarische Opposition im ADAV« sich schon zu Lassalles Lebzeiten bildet. Das Ausmaß des Lassalleschen Willens zur Kooperation ist seinerzeit noch unbekannt. Erst in der Zeit, als Bismarck die »Sozialistengesetze«, also das von 1878 bis 1890 währende Verbot der marxistischen Sozialdemokratie vorbereitet, wird sein Kontakt zu Lassalle, den dieser angebahnt hatte, öffentlich.
Beeinflusst auch durch seinen späteren sozialpolitischen Geheimrat Hermann Wagener war der preußische Ministerpräsident Bismarck als Vertreter der adeligen Großgrundbesitzerklasse aus machttaktischen Erwägungen offen für ein zeitweiliges Bündnis von konservativem Großgrundbesitz und Industriearbeiterklasse gegen die liberale Industriebourgeoisie. Während der Vorbereitung der »Sozialistengesetze« begründet Bismarck, warum es zu diesem Bündnis dann doch nicht kam: Lassalle habe »nichts hinter sich« gehabt, und sei darum auch »nicht der Mann« gewesen, »mit dem bestimmte Abmachungen über das do ut des abgeschlossen werden konnten«.
Dennoch ergriff Lassalle in der nationalen Frage eindeutig Partei, wie etwa seine Position zum Krieg um die Herzogtümer Schleswig und Holstein sowie seine deutschnationale Haltung gegenüber Napoleon III. zeigen. »Lassalles Ehrgeiz lag (…) nicht auf dem Gebiet des Landesverrats«, lobte dies SPD-Historiker Hirsch. Angesichts dessen versuchten die Sozialkonservativen um Wagener, den Lassalleanismus gegen das marxistische Gedankengut zu stärken. Dies geschah vor allem über Lassalles unmittelbaren Nachfolger als ADAV-Präsident, Johann Baptist von Schweitzer. Marx’ oft als rassistisch oder antisemitisch gedeutete Bezeichnungen von Lassalle als »wasserpolackischer Jude« und als »jüdischer Nigger« sind vor diesem Hintergrund zu sehen, dass er in Lassalles Verhalten opportunistische Unterwürfigkeit sah und in seinem Denken den Ausverkauf der Sozialdemokratie zugunsten des Obrigkeitsstaates witterte.
Lassalles Schüler
Die Auseinandersetzung zwischen den Anhängern Lassalles und denjenigen von Marx, die sich damals die »Eisenacher« nannten, prägt die Frühgeschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Als ADAV und SDAP 1875 in Gotha zu einer Partei fusionieren, passiert dies unter heftigem Streit über die Ausrichtung der gemeinsamen Organisation.
War der Versuch der Sozialkonservativen gescheitert, über Schweitzer die Sozialdemokratie in eine nationalloyale Richtung zu lenken, und mochte der linke Parteiflügel um Rosa Luxemburg, Clara Zetkin und Franz Mehring um die Jahrhundertwende auch noch davon ausgehen, Bernsteins nach dem Tod von Engels formulierten Revisionismus in der Partei besiegt zu haben, setzte dieser sich am Ende des Tages durch. Freilich trug auch die Schwäche in der Revolutionstheorie der Partei ihren wesentlichen Anteil an der Durchsetzung des Lassalleanismus bei, der über den rechten Parteiflügel auf direktem Weg zur Zustimmung der SPD zu den Kriegskrediten für den Ersten Weltkrieg führte: Denn vor dem SPD-Verrat von 1914 steht Bernstein, und vor Bernstein Lassalle.
Zunächst als Anhänger des Marxschen Denkens und Gegner des lassalleanischen Reformismus gestartet, macht Bernstein später keinen Hehl aus seiner Bewunderung für den ADAV-Gründer. 1892/1893 ist er Herausgeber einer dreibändigen Ausgabe von Lassalles »Reden und Schriften«, die die Grundlage bildet für die »Gesammelten Reden und Schriften«, die Bernstein dann 1919/1920 in zwölf Bänden plus einem Ergänzungsband herausgeben wird. Schon in seiner Zeit als Redakteur bei Der Sozial-Demokrat hat Bernstein sich positiv auf Lassalles Idee der »Produktivassoziationen mit Staatskredit« bezogen. Erschien diese Schrift 1884 noch unter seinem Pseudonym »Leo«, verfasst Bernstein 1904 dann für den Parteiverlag »Vorwärts« eine ganze Monographie, die »zu seinem vierzigsten Todestage« Lassalles »Bedeutung für die Arbeiterklasse« würdigt, gefolgt von dem Band »Intime Briefe Ferdinand Lassalles an Eltern und Schwester«.
Der Geist Lassalles lebt also in einer auf den Nationalstaat orientierten Reformpolitik der Arbeiterbewegung fort. Lassalle ist als Säulenheiliger fester Bestandteil von Identität und Parteifolklore, und man baut ihn zu einem Alternativprogramm zu Marx auf, verteidigt ihn gegen den doppelten Vorwurf, Marx-»Plagiator« oder doch bloß ein Junghegelianer des Vormärz zu sein. Statt dessen hebt man seine Rolle als, wie Hans Mommsen es formuliert, »eigenständiger, origineller Denker und darüber hinaus als Marx-Ersatz« hervor. Als sich 1964 sein Tod zum 100. Mal jährt, entfaltet sich in Westdeutschland entsprechend auch eine lebendige Debatte über das Erbe des ADAV-Gründers.
Wolfgang Michalka hat in seinem Nachwort zur damaligen Reclam-Ausgabe des »Arbeiterprogramms« richtig vermutet, dass die »Beschäftigung mit Lassalle ihre Ursache in einer Neuorientierung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands« habe, weil die Geschichte der SPD eben »von einer ständig sich erneuernden Konfrontation mit dem Marxismus geprägt« gewesen sei, »in der die Bezugnahme auf Lassalle eine ausschlaggebende Rolle« gespielt habe. Dass man sich in dieser Zeit zugleich mit dem »Godesberger Programm« – das 1959 aus einer Arbeiter- eine Volkspartei mit Bekenntnis zu kapitalistischer Marktwirtschaft und Landesverteidigung machte – vom Lassalle’schen Erbe als Arbeiterpartei selbst löste, erklärt aber ebenfalls, warum der Name Lassalle in der SPD zu verblassen beginnt.
Heute kann man sich eine Auseinandersetzung über Lassalle in der SPD kaum noch vorstellen. Die letzten Sozialdemokraten in der Partei betreiben noch etwas Folklore. In Wuppertal beispielsweise, wo Lassalle kurz vor seinem Duelltod bei einem ADAV-Fest eine programmatische Rede gehalten hatte, ließ der lokale SPD-Unterbezirk zum 140. Todestag eine Gedenktafel anbringen.
Eine inhaltliche Auseinandersetzung wäre indes eher in der Linkspartei gut aufgehoben, wo Funktionäre auf eine Aufweichung der Friedenspositionen der Partei und eine »konstruktive« Mitarbeit an der Landes- und Bündnisverteidigung gegen eine, von der Regierung erklärte, autoritäre Bedrohung von außen hinarbeiten. Da aber auch in der Linken eine Auseinandersetzung mit dem theoretischen Erbe der Partei kaum stattfindet, und Parteiführer heute, anders als früher, keine ausgearbeitete Kapitalismusanalyse mehr vorlegen müssen, aus der sich die Parteistrategie ableitet, ist für Lassalles 200. Geburtstag keine lebendige Theorie- und Geschichtsdiskussion zu erwarten. Sie wäre indes sinnvoll und nötig. Denn es steckt sicherlich gar kein Lassalle mehr in der Praxis der SPD, in der der Linkspartei aber zweifellos schon.
Ingar Solty schrieb an dieser Stelle zuletzt am 3. April 2025 über die Antideutschen, die heute in Reih und Glied mit der Nation in Waffen stehen: »Der Freund steht immer im Westen«.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ähnliche:
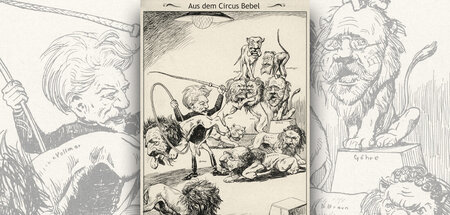 picture alliance / akg-images | akg-images06.01.2025
picture alliance / akg-images | akg-images06.01.2025Opportunismus als Symptom
 AG Geschichtsrevisionismus23.08.2024
AG Geschichtsrevisionismus23.08.2024Nationale Geisterhöhle
 ullstein bild/picture alliance06.08.2024
ullstein bild/picture alliance06.08.2024Aus der Art geschlagen

