Nicht zu kitten
Von Barbara Eder
Soviel ist verbürgt: 1937 wurde der ehemalige DWM-Eigentümer Günther Quandt zum »Wehrwirtschaftsführer« ernannt.¹ Sein Konzern nannte sich dazumal »Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik AG (DWG)«, die Berliner Dependance lag am Eichborndamm 103–127.² Im Faschismus machte Quandt mit Menschen und Waffen gleichermaßen fette Beute. Die Klassiker der Nationalökonomie im Gepäck, war er auf seiner »Pirsch« nicht allein. Adam Smith zufolge würde das Aufspüren von Bibern im Vergleich zu dem von Hirschen das Doppelte der Zeit in Anspruch nehmen; deshalb wären erstere im Verhältnis zu letzteren auch doppelt soviel wert. Günther Quandt monetarisierte Smiths frühe Jagderfahrungen und ging damit in Serie: Je mehr Tiere mit derselben Waffe erlegt werden können, desto geringer wird ihr Anteil am Gesamtwert der Beute pro Stück.³
Lukratives Geschäft
Am Vorabend der industriellen Massenproduktion galt dies nicht nur für Kleinkaliber. Mit Waffe und Beute betrieb Günther Quandt ein lukratives Geschäft. Zuerst jagte er nur in deutschen Wäldern, dann auch im russischen Permafrost; seine Hirsche kamen aus dem Osten, die Biber hingegen aus heimischen Sümpfen. Quandt tötete nicht sofort, er fing nur ein: Pro Wurf sinkt der Preis der Ware, das wusste auch Adam Smith. Besser also, man lässt das »Rotwild« am Leben und versklavt es dann – so auch die Gesamtkalkulation der durch Zwangsarbeit am Laufen gehaltenen Naziindustrie.
Neben dem für italienische Kriegsgefangene reservierten »Badener Lager« eröffnete Mauser im Oktober 1942 eine weitere Unterkunft am Berliner Eichborndamm. 1.320 aus Polen, Tschechien und der Sowjetunion verschleppte »Ostarbeiterinnen« und »Ostarbeiter« hausten in den Baracken und wurden zum Dienst am Reich gezwungen. In der Kriegsproduktion sind Kapital und Arbeit endlich eins. Müssen heißt wollen. Das Geforderte ist Robert Ley, dem Leiter der »Deutschen Arbeitsfront«, zufolge das Menschenmögliche an Rüstungsleistung – und das Maximum an Industrieprofit.
Allein im Sommer 1944 wurden rund 400.000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in deutschen Rüstungsbetrieben systematisch ausgebeutet.⁴ Im Herbst desselben Jahres mobilisierte das SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt noch die letzten »eisernen Reserven«: Menschen in KZ, darunter besonders viele aus Sachsenhausen und seinen Außenlagern, wurden der Waffenindustrie über eine reichsinterne Konzernholding zugeführt. Der Leiter des »Reichsministeriums für Rüstung und Kriegsproduktion«, zugleich auch »Generalinspektor für die Reichshauptstadt«, sorgte für ihre »betriebsnahe« Unterbringung. In und um Berlin herum ließ Albert Speer Massenunterkünfte errichten; in ihnen grassierten auch Tuberkulose, Ruhr und der Tod durch Entkräftung.
Der Riss in der Geschichte ist nicht zu kitten. Was zerrissen wurde, bleibt bestehen: W für Waffen, nicht für Waggons. Im Jahr 1952, sieben Jahre nach Kriegsende, wollten die Deutschen Waffen- und Munitionsfabriken davon nichts mehr gewusst haben. Der ehemalige Nazirüstungskonzern hatte sich in »Deutsche Waggon- und Maschinenfabriken« umbenannt, am Eichborndamm 129 bis 139 setzte er seine Produktion fort.⁵ Anfangs übte man sich noch in der Herstellung von Kältekammern, mit einem Eisschrankfabrikanten aus Übersee unterhielt DWM einen exklusiven Lizenzvertrag.⁶ Vor Ort wurden bis in die siebziger Jahre Reise- und Triebwägen, auch für die Deutsche Bundesbahn, hergestellt.
Sieben Jahre später standen am Eichborndamm die ersten Automaten.⁷ Jene, die sie hergestellt hatten, sollten sich damit selbst verpflegen. Ganztags gab es Dauerware und abends keine warme Suppe; doch immerhin: DWM, nunmehr Deutsche Waggon- und Maschinenfabriken GmbH, hat seinen Arbeitern ein Freiluftbad am Eichborndamm gebaut;⁸ in der Automatenproduktion blieb das Waschverbot während der Arbeitszeit dennoch bestehen. Die Betriebszeitung Der rote Weichensteller nimmt die falschen Verhältnisse in den Blick, der Schriftzug »Solidarität« durchzieht das DWM-Signet am Deckblatt der Ausgabe vom Dezember 1969. Darin heißt es: »Wir sagen: Den Dreck, den wir uns während der Arbeitszeit geholt haben, wollen wir auch in unserer Arbeitszeit wieder loswerden, und nicht in unserer Freizeit nach Feierabend. Wir fordern: zehn Minuten Waschzeit vor Feierabend.«⁹
Inge Mills Erbe
Non olet. Nein, es stinkt nicht. Nicht in den Händen derer, die es nie verdienten. Im »Dritten Reich« betrug der Nettowochenlohn eines »deutschen Arbeiters« durchschnittlich 44 Reichsmark, die sowjetische Arbeitskraft hingegen bekam nur fünf Reichsmark.¹⁰ Acht Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter kosteten soviel wie ein »Stammarbeiter«, der »Rabatt« rentierte sich – obgleich die Arbeitskraft aus »dem Osten« auch den Nazis als »minderwertige« Ware galt.
Nein, es hätte nicht gestunken. Auf die Ausbeutung fremder Arbeitskraft wollten die Deutschen Waggon- und Maschinenfabriken auch nach Kriegsende nicht verzichten. Im Dezember 1969 hält DWM-Betriebsrat Hoferichter erstmals Ausschau in entfernten Gebieten. In der Türkei kauft er Arbeiterinnen und Arbeiter ein, die pro Stunde 18 Pfennige weniger kosten als die deutschen.¹¹ Schon ein Jahr zuvor war seine Mission im kleineren der beiden »Orients« erfolgreich: DWM warb erfolgreich Arbeiter aus dem sozialistischen Jugoslawien an. Pro Arbeitskraft kassierte DWM 86 Deutsche Mark für eine Übernachtung in einem der zur Verfügung gestellten Vierbettzimmer, bestehend aus billigen Matratzen auf zwei Stockbetten;¹² doch immerhin: DAF heißt nicht mehr »Deutsche Arbeitsfront«. Die Betriebszeitschrift des Kommunistischen Bundes fordert in Ausgabe Nummer drei vom Dezember 1969 täglich zwei Stunden Deutschunterricht für die ausländischen Kollegen, während der Arbeitszeit.¹³ Auf dem Titelblatt heißt es: »Für Quandts Extraprofit: Türkische Arbeitskraft, billig.«¹⁴
Als Inge Julia Mills, geboren am 14. Mai 1919 als Inge Julia Königsberger in Berlin, wohnhaft in Gretna, Schottland, am 1. Januar 1959 eines der ersten Rückerstattungsverfahren gegen das »Deutsche Reich« in der BRD eröffnete, klagte sie im Namen ihrer Eltern. Sie forderte nicht alles, nur den Rest. Egon und Alice Königsberger hatten das DWM-Areal am Eichborndamm nach Monaten auszehrender Zwangsarbeit als Verwaltungsnummern verlassen; mit der ersten »Transportwelle« am 18. Oktober 1941 wurden sie in das jüdische Ghetto in Łódź deportiert.¹⁵ Inge Mills’ Anspruch auf den DWM-Restlohn ihres Vaters wurde nicht stattgegeben; in den Gerichtsakten hatte sich statt dessen ein Komma verschoben: Aus den georderten 1.865 Reichsmark sind 18,65 Reichsmark geworden, am Ende waren es nur noch eine Deutsche Mark und 87 Pfennige.¹⁶
Der Groschen
Ich schließe die Flügelmappe mit den Akten, knipse das Licht der Schreibtischlampe im Lesesaal des Berliner Landesarchivs aus, Adresse: Eichborndamm 115. Da ist er wieder, der Riss in der Plakette. Er bleibt für immer unverfugt. An dieser Bruchlinie beginnt eine andere Geschichte. Im Russischen konnotiert »работать« bis heute Fron und Zwangsarbeit; von jenen, die sie im Dienst der deutschen Industrie leisten mussten, weiß die Welt noch zuwenig.
Der Riss in der Plakette darf sich niemals schließen. An der glatten Oberfläche des Automaten, dem sie eingenagelt ist, spiegelt sich das Kameraobjektiv wie ein ausgehöhltes Auge, sein Metallmantel ein schwarzer Schrein, fast schon ein Sarg. Ich denke an die Arbeit, die in ihm steckt, vom Kopf zur Hand, Elle zur Zehe, entäußert am Eichborndamm: Berlin – Borsigwalde 36146. Erst dann werfe ich eine Münze ein. Wenn der Groschen fällt, ist nichts gewonnen. Ein Stück Geschichte, die eine der Zwangsarbeit ist, steht vor mir.
*
Anmerkungen
1 »Wehrwirtschaftsführer« war im »Dritten Reich« ein Ehrentitel, der von der NSDAP an die Leiter rüstungswichtiger Betriebe vergeben wurde. Im Fall Günther Quandts erfolgte die Verleihung im Anschluss an eine große Spende nach seinem NSDAP-Eintritt 1933 – die Nazis revanchierten sich dafür. Vgl. Joachim Scholtyseck: Der Aufstieg der Quandts: Eine deutsche Unternehmerdynastie. München 2011, S. 1.550
2 Vgl. baseportal.de/cgi-bin/baseportal.pl?htx=/Pagenstecher/zwa_firmen_berlin/zwa_firmen_berlin&cmd=list&range=160,20&cmd=all&Id=164 (abgerufen 27.2.2025). Cord Pagenstecher und Maren Brodersen betreiben mit Unterstützung der Berliner Geschichtswerkstatt die Datenbank über Firmen, die im Zweiten Weltkrieg in Berlin Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter beschäftigt haben
3 Diese Anspielung bezieht sich auf David Ricardos Erweiterung von Adam Smiths Hirsch-Biber-Modell. In seine Wertbemessung bezieht Ricardo die Zeit mit ein, die zur Herstellung einer Jagdwaffe vonnöten ist: »Without some weapon, neither the beaver nor the deer could be destroyed, and therefore the value of these animals would be regulated, not solely by the time and labour necessary to their destruction, but also by the time and labour necessary for providing the hunter’s capital, the weapon, by the aid of which their destruction was effected.«

David Ricardo: On the Principles of Political Economy and Taxation (1817), in: The Works and Correspondence of David Ricardo, herausgegeben von Piero Sraffa in Zusammenarbeit mit M. H. Dobb, Bd. I. Cambridge 2004, S. 23
4 Gernot Jochheim: Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, in: Ders: 27. Januar – Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Informationen zur politischen Bildung der BPB. Bonn 2016, online unter www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/info-aktuell/239456/zwangsarbeiterinnen-und-zwangsarbeiter (abgerufen 27.2.2025)
5 Vgl. Hans Günter Wagner: Ein Zeichen im Wandel der Zeiten: DWM. Rückblick auf die wechselvolle Geschichte eines Unternehmens. Berlin 1992
6 Vgl. www.vhkk.org/page/geschichte/pdf/DWM_Unternehmensgeschichte+.pdf (abgerufen 27.2.2025). Der Verein Historische Kälte- und Klimatechnik (VHKK) behandelt die DWM-Unternehmensgeschichte unter diesem Aspekt
7 Ebd. DWM produzierte rund zehn Jahre lang Verkaufsautomaten in einer Nebensparte, Geschäftsfelder wie Verkaufs- und Prüfautomaten, Materialprüfeinrichtungen und Tiefkälteanlagen wurden 1969 aufgegeben. Aus betriebsinterner Sicht vgl. dazu »Schließung des DWM-Automatenbaus – typisch für Berlin?«, in: Der rote Weichensteller Nr. 14/Februar 1971, S. 7
8 Der Fotograf Gert Schütz hat die dazugehörige Aufnahme im August 1954 im Auftrag der Deutsche Waggon- und Maschinenfabriken GmbH gemacht. In der Fotosammlung des Landesarchivs Berlin trägt sie die Signatur F Rep. 290, Nr. 0034802K00919
9 »Automatenbau. Sich waschen gehört zur Arbeit«, in: Der rote Weichensteller, Nr. 3/Dezember 1969, S. 5
10 Diese finale Schätzung wurde vom Dokumentationszentrum Zwangsarbeit publiziert, online unter www.ns-zwangsarbeit.de/alltag-zwangsarbeit/themen/44-mark-fuer-deutsche-5-mark-fuer-russen (abgerufen 27.2.2025). Der Wirtschaftswissenschaftler Thomas Kuczynski rechnete die Monatslöhne in seiner Berechnung hingegen nach Nazibetrieben auf und kommt zu dem Schluss, dass »Ostarbeiterinnen« und »Ostarbeiter« im Durchschnitt nur ein Drittel weniger verdienten, vgl. Thomas Kuczynski: Brosamen vom Herrentisch, Berlin 2004. S. 88
11 Vgl. »Betriebsvereinbarung macht’s möglich: Für Quandts Extraprofit: Türkische Arbeitskraft, billig«, in: Der rote Weichensteller, Nr. 3/Dezember 1969, Berlin, S. 1–3, hier: S. 1
12 Vgl. ebd., S. 2
13 ebd.
14 ebd. S. 1
15 Das Berliner Suchbüro (Tracing Office) des American Joint Distribution Committee (AJDC) legte nach dem Krieg eine Kartei an, die als »AJDC Berlin Deportation Index« bezeichnet wird. Darin erfassten AJDC-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter Informationen zu deportierten Berliner Jüdinnen und Juden. Diese sind digitalisiert und online erfasst – so auch die AJDC-Karten von Egon und Alice Königsberger, online unter collections.arolsen-archives.org (abgerufen 27.2.2025)
16 Die Akte zum Rückerstattungsverfahren von Inge Mills, aus der hier zitiert wird, befindet sich im Landesarchiv Berlin, B Rep. 025 Wiedergutmachungsämter von Berlin, Geschäftsstelle 5, Akt 10368/59. Die Archivalie enthält Details zu einem von Inge Mills initiierten Rückerstattungsverfahren mit einem Stempel der »Wiedergutmachungsämter von Berlin« vom 15. Dezember 1960
Barbara Eder ist freie Journalistin. Teil eins ihrer Reportage, »Der Riss in der Plakette«, erschien an dieser Stelle in der Ausgabe vom 15./16. Februar 2025
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ähnliche:
 Stefan Müller/IMAGO/PIC ONE01.02.2025
Stefan Müller/IMAGO/PIC ONE01.02.2025»Elon Musk passt gut ins Konzept«
 Florian Boillot20.01.2025
Florian Boillot20.01.2025Fabio De Masi zum Fall Gelbhaar: »Parabel über die Fallstricke öffentlicher Pranger«
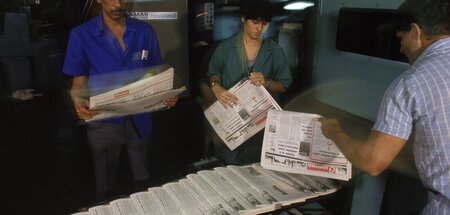 Jose Azel/Aurora Photos/imago11.01.2025
Jose Azel/Aurora Photos/imago11.01.2025Eine Zeitung für die Revolution
Regio:
Mehr aus: Wochenendbeilage
-
»Wenn wir dagegen sind, müssen wir das sagen«
vom 01.03.2025 -
International versippt
vom 01.03.2025 -
Tödlicher werden
vom 01.03.2025 -
Israels jüngste Invasion
vom 01.03.2025 -
Weißkohl-Okonomiyaki
vom 01.03.2025 -
Kreuzworträtsel
vom 01.03.2025
