Die Ordnung der Arschlöcher
Von Ken Merten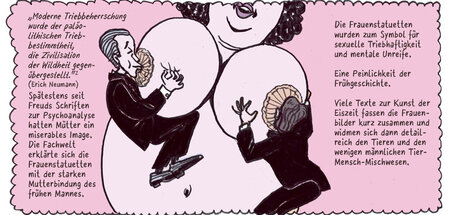
Er sei »kein Arschloch, er weiß halt einfach nicht so richtig, wie man lächelt«, redet Gym-Betreiber Jürgen in Helene Hegemanns viertem Roman »Striker« einen Sparringspartner schön, den Hauptfigur N probieren soll. Die hat einiges vor der Nase: Ihr Kontostand ist dauerhaft unter Null, die Affäre mit einem Regierungsmitglied ist in die romantische Roboterphase getreten, im Treppenaufgang hausiert eine Grenzgängerin ihrer Privatsphäre, und zudem steht der Cage Fight gegen die ärgste Konkurrentin an. Die wiederum vermarktet sich stets in Strandnähe, und zur Vergrößerung der Reichweite heult sie sich in Videos auch mal aus, weil die Narkose schiefging und sie im Wachzustand miterleben musste, wie ihr der Zinken im serbischen OP-Saal per Hammer und Meißel aufgehübscht wurde. Jürgens Lösung: N soll sich vor dem Käfigkampf mit der Krawallbarbie abhärten und vom Nichtarschloch verdreschen lassen, bis sie des Umkippens unfähig wird.
»Jack Kerouac hat seine Generation an den Wahnsinn verloren. N, die Jack Kerouac nicht kennt, aber mögen würde, verliert ihre Generation gerade an Instagram.« Hier spricht sicherlich die jung zu Ruhm und – ob der Plagiatsvorwürfe – Schimpf gelangte Autorin von »Axolotl Roadkill« (Ullstein-Verlag, 2010) direkt zur Leserschaft. Dahinter steckt allerdings auch die Handlung Betreffendes: N prügelt sich so professionell wie passioniert, initiiert, als sie an der mütterlichen Aufsicht vorbei den Kampf zwischen Lennox Lewis und Mike Tyson im Fernsehen verfolgte. Sie registrierte, dass »Gewalt am gefährlichsten ist, wo sie unterdrückt werden soll. Und dass sie zu Rettung und Aufrichtigkeit führt, sobald sie in einem Rahmen ausgeübt wird, in dem man sie einander zumuten und sich dadurch Respekt zollen kann.« Die sich als Internetmode präsentierende Konkurrenz aber kämpft asymmetrisch, weil sie außerhalb des Rings auch noch in anderen Rahmen zum Wettkampf auffordert. N kann und will dort nicht mitspielen, auch wenn ihr die Nichteinmischung keinen Vorteil bringt, da Botox und Werbedeals nicht dazu führen, dass ihre Gegnerin als Kämpferin abbaut.
Willkommen, Wahnsinn
Statt dessen schuftet N, um die Miete in Berlin stemmen zu können, in Jürgens Sportschule als Trainerin, dem Ort, wo »es keine Trennung gibt, keine Ausgrenzung, nur Hierarchie; hinter denen das durch irgendwelche Judoanzüge gesickerte Menstruationsblut mit derselben Routine abgenickt wird wie jemand, dem zu schnell die Äderchen in der Nase platzen«. Außerhalb, in der Welt, herrscht idiotische Ausgrenzung und eine bloß per Ordnung legitimierte Hierarchie der Arschlöcher.
N beobachtet die Wohnungslosen am Kanal, die sich als Vogelfreie in unsichtbaren Käfigen nicht vor dem nahenden Winter schützen werden können. Ivy, die Frau, die sich in Ns Umgebung als heimliche Nachbarin mit destruktiver Haushaltsführung bereits bekannt gemacht hat, weist N nicht nur auf den titelgebenden Streetartist Striker hin, die beiden Figuren verschwimmen miteinander: Ein Steckbrief, der vor Ivy warnen soll, beschreibt ebenso das Äußere von N. Sie scheint sich selbst Stück für Stück an den Wahnsinn zu verlieren.
Wo sich in »Bungalow« (Hanser-Verlag, 2018) Väter beim Mittagsschlaf auf dem Sofa im Plattenbau auf ihre Babys wenden und sie so ersticken, ist Hegemanns Sozialrealismus in »Striker« zwar ebenfalls stark bebildert, jedoch weniger drastisch: Ja, Instruktionen, wie man einen Vergewaltiger abwehrt, indem man ihm den Oberarm bricht (»Je muskulöser er ist, desto schneller geht es, weil sich Gewalttäter ihre Kraft so unkoordiniert antrainieren, dass sie dabei den letzten Rest Flexibilität verlieren«), gibt es, aber die Gewalt-, Drogen- und Sexexzesse, die sich in Hegemanns Büchern am Fließband finden, fehlen hier, da Kampfsport der Hauptstoff des Romans ist. Das trifft sich und mag zudem auf einen Prozess der Mäßigung der 33jährigen Autorin verweisen; und tatsächlich bewegt sich der Roman »Striker« nicht nur sprachlich in eine leicht mit Kapitulation zu verwechselnde Richtung der Versöhnung: die mit der namenlosen Politikerin, die mit der manischen Schnorrerin Ivy.
Drinnen wie draußen
Die postpandemische Gesellschaft aber hat vieles nicht gelernt, auch nicht Maß und Bedingungen, die es für Versöhnung braucht: Striker (der, wie in einem angehängten Paratext angedeutet wird, dem Berliner Wandmaler Paradox nachempfunden sei) lockt als esoterischer Sprücheklopfer einen so mannstarken wie rechts-links-schwachen Fanhaufen in seinen Onlineshop.
Statt der Moralkeule werden in Helene Hegemanns »Striker« zwar die Fäuste geschwungen. Laborzustände unterscheiden sich jedoch vom verkeimten Freien. Die abgesteckte Auseinandersetzung auf Augenhöhe ist als Ideal für ein Weltverständnis unzulänglich. Gegen Übergriffe in der Öffentlichkeit setzt N sich nicht zur Wehr, obwohl sie könnte. Das vom HNO-Hobbyarzt Tyson operierte rechte Ohr Evander Holyfields fünf Jahre vor dem Kampf gegen Lewis zeugt andererseits davon, dass es auch im Ring so eklig zugehen kann wie außerhalb. Dort, wo es vice versa auch um Aufrichtigkeit und Respekt gehen muss.
Helene Hegemann: Striker. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2025, 192 Seiten, 23 Euro
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Rotlicht: Kredit
vom 26.03.2025 -
Nachschlag: Einen zum Abgewöhnen
vom 26.03.2025 -
Vorschlag
vom 26.03.2025 -
Veranstaltungen
vom 26.03.2025 -
Vier Druckfehler
vom 26.03.2025 -
Holland-Moritz, Pietsch, Jurichs
vom 26.03.2025 -
Frieden sichern
vom 26.03.2025 -
Spur der Steine
vom 26.03.2025 -
Er kennt keinen Schmerz
vom 26.03.2025
