Labor des Ethnonationalismus
Von Stefan Ripplinger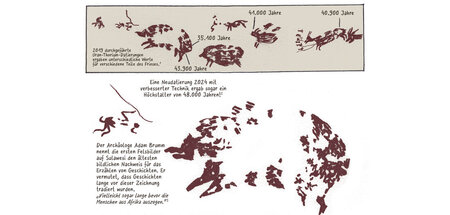
Mit Donald Trumps »Riviera-Plan« – das Leichenfeld Gaza als Ferienparadies – ist immerhin eine Lüge vom Tisch: Die israelischen Streitkräfte (IDF) hätten Gaza allein deshalb plattgewalzt, um die Tunnel der Hamas zu zerstören. Gegen diese Lüge spricht allein schon, dass Trumps Plan nicht nur von der israelischen Rechten, sondern auch von den Liberalen Benny Gantz und Jair Lapid unterstützt wird.
Aber hat diese Lüge je irgendwer geglaubt? Bereits zwölf Tage nach dem mörderischen Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 meldeten neun Berichterstatter der Vereinten Nationen, es bestehe in Gaza die Gefahr eines Genozids. Sie schlossen das aus israelischen Verlautbarungen, von denen wenige Monate später Südafrika dem Internationalen Gerichtshof eine beeindruckende Liste vorlegen konnte. Unter anderem hatten die Spitzen des Staates von einer Kollektivschuld der Palästinenser gesprochen. Als israelische Minister im Juni 2024 einem Mob voranschritten, der »Tod den Arabern« grölte, bedurfte es schon keines Beweises mehr.
Es stellt sich deshalb die Frage, weshalb der Westen dieses vor den Augen der ganzen Welt geplante und durchgeführte Massaker nicht nur dulden, sondern aktiv unterstützen konnte, das doch die eigenen Sonntagsreden heuchlerisch erscheinen lassen muss. Pankaj Mishra und Didier Fassin widmen sich dieser Frage in aktuellen Büchern.
Der französische Arzt und Anthropologe Fassin vermutet in »Une étrange défaite« im wesentlichen drei Motive für die Unterstützung des Westens: Erstens wolle er sich von Schuld und Mitschuld am Holocaust reinwaschen – mit dem Blut derer, die schon seit dem Abraham-Abkommen als lästiges Überbleibsel gelten. Zweitens brauche er Israel als seinen Brückenkopf im Nahen Osten. Drittens sei die militärische Unterstützung (Deutschland liefert 30 Prozent der Mordwerkzeuge) immer auch eine Subvention der eigenen Rüstungswirtschaft. Das ist alles plausibel, doch Mishra nennt noch ein viertes, viel näher liegendes Motiv: Israel dient als »›Labor‹ für die Herstellung und Erprobung von Instrumenten« des Ethnonationalismus. Der Ethnonationalismus will Amerika den Amerikanern, Deutschland den Deutschen, Ungarn den Ungarn vorbehalten, von den »Wahren Finnen« zu schweigen. Israel demonstriert, was zu diesem Behuf getan werden kann.
Fassin und der indische Essayist Mishra stimmen darin überein, dass es zwei miteinander unvereinbare Sichtweisen des Geschehens in Gaza gibt – die des imperialen Westens und die des globalen Südens. Von ihnen hängt ab, auf welches Datum der Beginn des Konflikts gelegt wird. Israel und seine Verbündeten, die USA und die meisten Europäer (außer Spanien und Irland) datieren ihn auf den 7. Oktober, also auf den Angriff der Hamas, der sie die Schuld an den Exzessen der IDF geben wollen. Dagegen gehen manche aus dem Süden bis zur Balfour-Deklaration von 1917 zurück, mit der die Briten die Zionisten nach Palästina einluden. Die meisten aber würden, trotz der Nakba, wohl im Jahr 1967 den Wendepunkt sehen. Denn nach dem Sechstagekrieg wurde Israel vom Hort der Verfolgten zu einem der Verfolger. Nach 1967 hat es den Palästinensern 100.000 Hektar Land entwendet, 50.000 Gebäude auf diesem Land zerstört und dort 700.000 Siedler untergebracht. Gewalt war und ist dafür unverzichtbar.
Dass diese Ereignisse Israel in ein neues Licht rückten, belegt der enorm belesene Mishra. Ich picke einige seiner Lesefrüchte heraus: Als letztes Jahr Jean Amérys Polemiken gegen den Antisemitismus der Neuen Linken erschienen, priesen die Neokonservativen das Buch in höchsten Tönen. Hier hatte sich ein Holocaustüberlebender auf die Seite Israels und gegen die Linke gestellt. Nicht erwähnt wurde, dass der von den Nazis gefolterte Améry der Sunday Times vom 19. Juni 1977 entnahm, in israelischen Gefängnissen werde gefoltert. Daraufhin schrieb er, kurz vor seinem Selbstmord, es gebe auch Grenzen in der Solidarität mit Israel. (Die Folterungen setzen sich fort, laut eines UN-Berichts starben 2024 binnen zehn Monaten 54 Personen an den Folgen.) Améry erlaubte sich, wenn auch spät, eine Kritik an Israel. Er war nicht der einzige Überlebende, der das tat. Andere – prominent Marek Edelman, ein Kommandant des Aufstands im Warschauer Ghetto, und Primo Levi – gingen wesentlich weiter. Viele Überlebende waren entsetzt davon, dass mit ihrem Leid neues Leid gerechtfertigt werden sollte.
Bekanntlich stellen etliche, die Israel unterstützen, den 7. Oktober in den Zusammenhang des Holocaust. Zwar handelte es sich um einen grausamen Anschlag gegen die Zivilbevölkerung, doch ihn mit der Vernichtung der europäischen Juden zu vergleichen, entleert nicht nur den Begriff, sondern bedient auch das von der israelischen Propaganda, der Hasbara, entwickelte Narrativ, die Araber seien die neuen Nazis; für die nach rechts driftenden Staaten des Westens bietet das überdies den Vorteil, die letzten Linken zu kriminalisieren (jüdische Linke ausdrücklich eingeschlossen).
Mishra schreibt, für den Süden hätten weder der Holocaust noch die Weltkriege je eine so große Rolle gespielt wie die Dekolonisierung. Das historisch wechselhafte Verhältnis des Südens, aber auch der nichtweißen Bevölkerungen zu Israel und den Juden erklärt sich so. Als sich Israel emanzipierte, erfuhr es viel Solidarität von anderen, die sich emanzipiert hatten. Ohnehin war Antisemitismus, anders als überall in Europa, in Asien praktisch unbekannt. Indiens sozialistische Führer besuchten in den 50er Jahren Israel, das ein Modellstaat auch für Ahmed Ben Bella, den späteren Präsidenten Algeriens, war und von Intellektuellen, wie dem iranischen Schriftsteller Dschalal Al-e Ahmad, bewundert wurde. Der afroamerikanische Bürgerrechtler Langston Hughes sagte schon 1937, was den Juden widerfahre, sei keine Überraschung für seinesgleichen: Die »Theorien nordischer Überlegenheit (…) sind für uns schon lange Realität«.
Heute findet Israel Unterstützung bei allen Praktikerinnen und Praktikern der nordischen Überlegenheit, von Trump und dem Antisemiten Viktor Orbán über Marine Le Pen, Alice Weidel bis Jair Bolsonaro und Javier Milei. Islamophobie begründet die Freundschaft zwischen Benjamin Netanjahu und Narendra Modi. Seit vorigem Jahr wird in Belgien geborenen Kindern palästinensischer Eltern die belgische Staatsangehörigkeit verweigert. Mishra versteigt sich zu der Behauptung, all das unterminiere die Überzeugung, dass »der Mensch ein zutiefst ›moralisches‹ Wesen« sei. Aber an dieser Überzeugung zweifelte schon Abel, bevor er von Kain erschlagen wurde. Fassin nennt sein Buch »Eine seltsame Niederlage« nach Marc Blochs Bericht vom Einmarsch der Deutschen in Frankreich 1940. Aus einer militärischen wird eine moralische Betrachtung. Doch das Militärische oder wenigstens das Strategische ebenfalls zu bedenken, hätte Fassin und Mishra gutgetan. Moral überzeugt nur die Gleichgesinnten, sicher nicht die Stützen des Staates samt seinen Literaturnobelpreisträgerinnen und Zeitungsherausgebern.
Pankaj Mishras genialisch verzettelter und Didier Fassins luzide-straighter Essay seien allen empfohlen, die einen von Staatspropaganda ungetrübten Blick auf das schreckliche Geschehen werfen wollen. In diesen beiden Büchern ist, ganz nebenbei, der Untergang einer Hegemonie skizziert.
Pankaj Mishra: Die Welt nach Gaza. Aus dem Englischen von Laura Su Bischoff. Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2025, 304 Seiten, 25 Euro
Didier Fassin: Une étrange défaite. Sur le consentement à l’écrasement de Gaza. La Découverte, Paris 2024, 190 Seiten, 17 Euro
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ähnliche:
 Mohammed Torokman/REUTERS23.11.2024
Mohammed Torokman/REUTERS23.11.2024»Israel ist nicht überlebensfähig«
 Florion Goga/REUTERS05.10.2024
Florion Goga/REUTERS05.10.2024»Nur wenige jüdische Israelis haben eine antizionistische Einstellung«
 Eldan David/Pressebüro der Regierung Israels/dpa15.05.2024
Eldan David/Pressebüro der Regierung Israels/dpa15.05.2024Verbot statt Debatte
Mehr aus: Feuilleton
-
Rotlicht: Kredit
vom 26.03.2025 -
Nachschlag: Einen zum Abgewöhnen
vom 26.03.2025 -
Vorschlag
vom 26.03.2025 -
Veranstaltungen
vom 26.03.2025 -
Vier Druckfehler
vom 26.03.2025 -
Holland-Moritz, Pietsch, Jurichs
vom 26.03.2025 -
Frieden sichern
vom 26.03.2025 -
Spur der Steine
vom 26.03.2025 -
Er kennt keinen Schmerz
vom 26.03.2025
