»Kein ›Chapeau‹ vor toten Heroen«
Von Vincent Sauer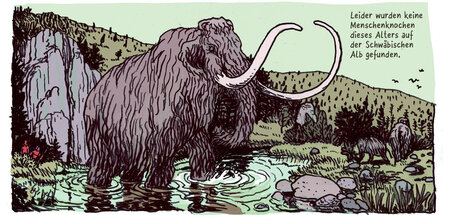
Fangen wir frech an: Ich verstehe den Titel ihres Buches, »wolken westwärts«, als Anspielung an Rolf Dieter Brinkmanns großes BRD-kritisches Werk »Westwärts 1 & 2«, das 1975 erschien. Wie hat sich Ihrer Meinung nach die deutschsprachige Literatur in den vergangenen 50 Jahren entwickelt? Sie mischen ja seit mehr als 30 Jahren mit.
Titel und Untertitel ergeben sich aus Zitaten im Text, sind kein »Chapeau« vor toten Heroen. Henze sieht im Zug nach Köln ausm Fenster; »wolken westwärts« heißt wohl, dass der Ermittler ausm Osten kommt. Aber wer weiß … Das Feld »50 Jahre Literatur« ist zu groß, um sinnvoll davon an dieser Stelle zu sprechen. Die Lyrik von Ben Lerner – bekannt durch seinen Essayband »Warum hassen wir Lyrik?« – ist Gegenstand der Ermittlung, weil die Tote im Text einem Lesekreis angehörte, der sowohl karrieretechnisch sinnvoll als auch meditativ entlastend sein sollte. Vermutlich ein Seitenblick zur Frage der Rolle von bürgerlicher Literatur in spätkapitalistischen Entwertungszusammenhängen, aber für die Ermittlung ist es ein Nebenschauplatz.
Der Untertitel des Buches lautet »ermittlungen zweiter ordnung«. Der Erzähler, Michael Henze, ist tatsächlich ausrangierter Detektiv, aber kein abgehalfterter Cop. Es gibt einen Mord an einer Frau in Triest, den er aufklären soll. Der Krimi ist eine literarische Form, die zur Gesellschaftskritik taugt, geht es doch um die Gewalt der Verhältnisse von unten wie von oben. Gleichfalls entsteht in diesem Genre unglaublich viel sedierender Schund. Buchmessenfrage: Was machen Sie in Ihren Ermittlungen anders im Hinblick auf Kategorien wie Spannung, Täter/Opfer, Polizeiarbeit?
Henze erinnert einen Text von Edgar Allan Poe, »Man of the Crowd«, der am Anfang sowohl der soziologischen Beschreibung als auch der Entfaltung des Genres Krimi steht. Solche Texte skizzieren die Konstellation, deren Sichtung zu Motiven der Akteure führt. Im vorliegenden Fall sind Sedimente zu sichten, denn polizeiliche Arbeit ist ergebnislos geblieben – zweite Beobachtung heißt dann Rezeption … im Auftrag von wem, wird zunehmend problematisch. Die Auftraggeberin schickt Henze auf eine Spur, die ihn langsam vermuten lässt, er folge der Auftraggeberin selbst. Ein Rückkoppeln in die Strukturen, die wir uns schaffen, um uns in ihnen zu verlieren. Die Tote arbeitet in einem derzeit nicht untypischen Unternehmen, das Ersatzrealitäten verbreitet – es sollen maximale Empfindungswelten extrahiert und gegen Höchstpreis an eine exklusive Kundschaft vertickt werden. Emotion als Ware ist nicht neu, Kulturindustrie ein dafür schon lange etablierter Begriff. Henze zieht nun nicht ballernd zwischen den Agenten umher, um eine Wahrheit zu finden, die wir schon ahnen können – der Ermittler verstrickt sich bis an den Punkt, sich zu fragen, ob Gefühle konsumierbar oder nur von Bedeutung sind, wenn sie selbst erfahren werden. Auch als negative. Auf Optimierung fixiert entstehen nur Phantasmen des Maximalen anstelle von Sinn. Spannung, die uns nicht zum Denken in unvertrautem Gelände motiviert, ist nur billiger »suspense« …
Henze kommuniziert mit Auftraggeberin Eliza, von der nicht klar ist, ob sie Mensch ist oder KI. Sie wollen aber nicht einfach menschliche expressive Gefühlskräfte gegen tote und generische Computertexterei ausspielen, würde ich sagen. Dafür ist Ihr Detektiv zu intellektuell. In ihrem Buch wird allerlei Theorie herangezogen. Auch mal Goethe, aber Henze versucht seine Welt vor allem mit Hilfe kritischer Geister der jüngeren Vergangenheit zu verstehen, etwa Jean Baudrillard. Theorie, Fiktion, Essay, das verschwimmt in Ihrem Buch …
Na ja, Goethe taucht als gern gewähltes Exempel eines GröDaZ auf, jenes größten bourgeoisen Dichters aller Zeiten – Henze ist genervt davon, den Mann in Versuchen von Hobbyintellektuellen noch immer vertreten zu finden. Tatsächlich koppelt sich sein Ermitteln an diverse vorhandene Analysen gesellschaftlicher Zusammenhänge. Wie jedes Schreiben die Lektüre zahlreicher vorgängiger Texte ist, folgt auch Investigation nicht nur zählbaren Daten, sondern taucht in menschliche Vorstellungswelten ein. Die digital entnommene und reproduzierte Empfindung bleibt stromlinienförmiges Optimum, solange kein Gefühl fürs Scheitern es in der Realität zu echter Erkenntnis aufmischt. So verschwimmt nicht nur Theorie und Tat, auch das Täter-Opfer-Setting wird so vielleicht auf den Kopf gestellt …
Ralf B. Korte: wolken westwärts. ermittlungen zweiter ordnung. Verlag Klingenberg, Garz 2025, 192 Seiten, 22,90 Euro
Ralf B. Korte, geb. 1963 in Ulm, lebt in Berlin. Er ist seit 1991 Mitherausgeber der Literaturzeitschrift Perspektive. Zuletzt erschien 2023 im Ritter-Verlag »tagewaise. notate«.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Rotlicht: Kredit
vom 26.03.2025 -
Nachschlag: Einen zum Abgewöhnen
vom 26.03.2025 -
Vorschlag
vom 26.03.2025 -
Veranstaltungen
vom 26.03.2025 -
Vier Druckfehler
vom 26.03.2025 -
Holland-Moritz, Pietsch, Jurichs
vom 26.03.2025 -
Frieden sichern
vom 26.03.2025 -
Spur der Steine
vom 26.03.2025 -
Er kennt keinen Schmerz
vom 26.03.2025
