Achsen der Heimsuchung
Von Barbara Eder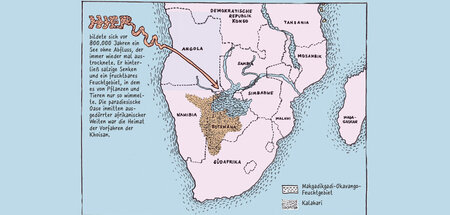
»In Melanesien bezeichnet der Schenker die prächtigsten Geschenke, die er dem rivalisierenden Häuptling zu Füßen legt, als seinen Abfall«, heißt es an einer Stelle von Georges Batailles »Die Aufhebung der Ökonomie«. Darin treibt der Autor ein Prinzip auf die Spitze, das Marcel Mauss zufolge am Ursprung aller Vergemeinschaftungsformen steht. In seinem 1925 erstmals veröffentlichten »Essai sur le don« stellt Mauss nicht ohne Ernüchterung fest, dass der Gabentausch selbst in archaischen Gesellschaften nicht aus freien Stücken geschieht. Jedes Potlatsch-Ritual geht mit der Verpflichtung zur Gegengabe einher – und initiiert somit einen Circulus vitiosus von demonstrativer Verschwendung und wechselseitiger Überbietung, was sich unter kapitalistischen Bedingungen vor allem als Vernichtungsaktion durch das Kapital selbst zeigt.
In naher Zukunft muss der Beschenkte mehr geben als das, was ihm gegeben wurde – und somit einen Überschuss erwirtschaften, dessen Preisgabe sein Herabsinken in den Stand des Unfreien gerade noch verhindern kann. Das zellophane Zierwerk des Gegenübers stellt Schuldknechtschaft in Aussicht, deshalb bezeichnet Georges Bataille das Geschenk auch »als Verlust, und damit als partielle Zerstörung«; im Moment seiner Übergabe wird die Zerstörungslust des Schenkers auf den Beschenkten übertragen. Der Wunsch nach der Vernichtung der gegnerischen Partei steht am Ausgangspunkt dieser Ökonomie – im Sinn eines tödlichen Spiels auf Zeit. Simon Nagys Essay mit dem Titel »Zeit abschaffen« beginnt hingegen mit dem unendlichen Aufschub. Er fordert Zeit, die es nicht gibt – und damit die Unterbrechung aller tauschwertzentrierten Beziehungen, die Menschen in ein Netz gegenseitiger Abhängigkeiten einbinden.
Die Idee ist keineswegs neu, doch denkt der Autor sie anders: Bereits in der 15. These seines Fragments »Über den Begriff der Geschichte« nahm Walter Benjamin die Bedeutung von Zeitmessungsinstrumenten am Vorabend der Französischen Revolution in den Blick. Die Uhr galt den Sansculotten als Symbol feudaler Herrschaft, noch in den ersten Tagen der Julirevolution feuerten sie auf Kirchturm- und Rathausuhren. Mit diesem Akt sollte die postmonarchische Zeitrechnung anfangen, der Rest ist Dialektik im Stillstand: Nicht mit dem revolutionären Moment, sondern einem vereitelten Anschlag beginnt Simon Nagys Buch. Als der französische Anarchist Martial Bourdin im Jahr 1894 loszog, um die Shepherd Gate Clock am Eingang des Royal Observatory in Greenwich zu sprengen, explodierte seine Bombe zu früh. Der Aufstand gegen die standardisierte Zeit und den in ihr angelegten Fortschrittsgedanken fängt mit einem tödlichen Unfall an.
Zäsuren in der Zeit führen nicht zwangsläufig zu ihrer Aufhebung. Selbst dann, wenn alle Messinstrumente temporär außer Kraft gesetzt wären, verginge die Gegenwart weiterhin im Takt von Stunden, Minuten und Sekunden. Kapitalistische Produktionsprinzipien organisieren nicht nur die Welt der materiellen Dinge, sondern auch die Wahrnehmung von Zeit: Die Ware ist nie fertig, die Zukunft nie erreicht, und das Leben findet nie im Jetzt statt. Egal, ob linear oder abstrakt, vermessen oder gestundet – die Zeit der Gegenwart verstreicht im Rhythmus der Produktion: Je mehr in kürzerer Zeit hergestellt werden kann, desto größer der Mehrwert für das Kapital – und um so geringer der Anteil an freier Zeit für alle Arbeitenden. Moishe Postone zufolge ist Arbeitszeit im Kapitalismus die zentrale Wertgröße, das in ihr zu vollbringende Soll nivelliert sich seit Jahrhunderten konstant nach oben. Je nach Produktivitätsentwicklung wird die gesellschaftliche Arbeitsstunde neu verhandelt, dasselbe Quantum an abstrakter Zeit wird dabei in Gegenwartszeit umgewandelt.
In Konsequenz von Postones Argumentation ist für Nagy der Klassenkampf keiner um höhere Löhne allein; vielmehr müsse sich ein solcher gegen die Wertproduktion selbst richten. Deren Basis ist »das Wirtschaften mit menschlicher Lebenszeit, die im Moment ihrer Verwertung verdinglicht, also zu einer Eigenschaft externalisierter Objekte gemacht wird«. Die Wertproduktion wäre demnach identisch mit der Arbeit im Kapitalismus, diese durchzieht jedoch ein fundamentaler Widerspruch: Während abstrakte Zeit als homogene und messbare Einheit fungiert, ist konkrete Zeit an soziale Prozesse gebunden. Letztere muss infolge der Tendenz des Kapitals »to convert it to surplus labour« (Marx) gesellschaftlich erst erkämpft und angeeignet werden, Marx selbst bezeichnete diesen Kampf als einen um »disposable time«.
Jenes Quantum an Zeit, das uns unter diesen Bedingungen zum Leben bleibt, ist nicht einfach nur »vollgeräumt« und »kaputt«, sondern strukturell deformiert. In ihr unterwirft das Kapital die menschliche Erfahrung der Verwertungslogik und beutet diese gnadenlos aus. Im Gegenzug dazu beschwört Nagy die Geister linker Theoriegeschichte. Das »Gespenst des Kommunismus«, mit dem Karl Marx und Friedrich Engels das »Manifest der Kommunistischen Partei« von 1848 einleiteten, befindet sich ebenso in seiner Ahnenreihe wie Jacques Derridas »Spectres de Marx« und Mark Fishers Hauntologie. Diese Lemuren bevölkern das imaginäre Zwischenreich von »nicht mehr« und »noch nicht« – und damit die Gegenwart der Vergangenheit ebenso wie die Möglichkeit einer Zukunft, die noch nicht ist. Entlang dieser Achsen der Heimsuchung entfaltet sich der utopische Raum eines »no longer« und »not yet«.
Nagy will die Vermessung dieser Zwischenzone nicht den falschen Propheten von Kybernetik und Systemtheorie überlassen. Technisch induzierte Homöostasen führen nicht in die Zukunft, sondern begrenzen den Raum der Gegenwart radikal. Seine Ambition, die Zeit selbst abzuschaffen, beginnt statt dessen mit der Wiederbelebung aller bislang uneingelösten Versuche, kapitalistische Herrschaft ein für allemal zu überwinden. Neue soziale Bewegungen, darunter auch die zweite Frauenbewegung, haben sich in diesem Ringen verdient gemacht, im Zuhause gilt seither das Ideal der partnerschaftlichen Arbeitsorganisation. Die Forderung nach einer flächendeckenden Reduktion von Erwerbsarbeit bei gleich bleibendem Lohn ist bis heute jedoch uneingelöst. Unter kapitalistischen Bedingungen wird sie zu einer Frage der richtigen Work-Life-Balance – und ruft im Privaten fordistische Formen der Arbeitszeitorganisation erneut auf den Plan.
Simon Nagy kritisiert die systematische Ausblendung reproduktiver Arbeit aus den Wertsphären des Kapitals und geht damit über die klassische Kritik am Erwerbsregime hinaus. Er würdigt Silvia Federicis Konzept der »Lohn für Hausarbeit«-Bewegung der 70er Jahre als revolutionäres Moment im Kampf gegen die Zeit der Vernutzung. Dennoch fordert er nicht einfach nur Geld für Hausarbeit, sondern deren Anerkennung als Fundament der kapitalistischen Produktion selbst. Wenn diese Arbeit nicht oder nicht mehr geleistet wird, geraten deren Grundfesten ins Wanken. Das Schießen auf Uhren könnte dieser Tage mit der Abschaffung von Lohnarbeit und Kleinfamilie beginnen. Menschen in den Armenvierteln von Buenos Aires wagten in Reaktion auf die Wirtschaftskrise von 2001 einen Neuanfang: Sie verlagerten die Reproduktionsarbeit von ihren Behausungen auf die Straße. In den Nachbarschaftsküchen kochten Männer und Frauen für ganze Viertel, die Kinderbetreuung reorganisierten sie im Kollektiv. In Momenten wie diesen wird die Zeit des Sozialen neu verhandelt. Nagys Buch macht Lust darauf, Versuche dieser Art für ein Leben im Hier und Jetzt aufzugreifen – ohne Gegengabe und »sans phrase«.
Simon Nagy: Zeit abschaffen. Ein hauntologischer Essay gegen die Arbeit, die Familie und die Herrschaft der Zeit. Mit einem Nachwort von Clemens J. Setz. Unrast-Verlag, Münster 2024, 188 Seiten, 14 Euro
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Rotlicht: Kredit
vom 26.03.2025 -
Nachschlag: Einen zum Abgewöhnen
vom 26.03.2025 -
Vorschlag
vom 26.03.2025 -
Veranstaltungen
vom 26.03.2025 -
Vier Druckfehler
vom 26.03.2025 -
Holland-Moritz, Pietsch, Jurichs
vom 26.03.2025 -
Frieden sichern
vom 26.03.2025 -
Spur der Steine
vom 26.03.2025 -
Er kennt keinen Schmerz
vom 26.03.2025
