Für ein freies Afrika
Von Volker PotrykusDer Sammelband »Dekolonialer Marxismus« enthält Artikel und Vortragstexte von Walter Rodney aus den Jahren 1966 bis 1979 – der letzte erschien ein Jahr vor seiner Ermordung durch Staatsagenten in seiner Heimat Guyana im Alter von nur 38 Jahren. Rodney gehörte mit C. L. R. James, W. E. B. Du Bois, Frantz Fanon, Amílcar Cabral und Eric Williams zu den Revolutionären aus der Karibik und Afrika, die marxistische Theorie als unverzichtbar für die Abschaffung kolonialer und kapitalistischer Unterdrückung ansahen.
Im Vortrag »Der Marxismus als Ideologie der Dritten Welt« heißt es, jener könne »nur dann von Wert sein (…), wenn das, was er für das Universelle hält, auf das Partikulare angewandt wird. Und gerade an der Partikularität dieser Bemühungen wird sich zeigen, dass das Universelle tatsächlich universell ist und dass es anwendbar ist.«
In diesem Sinne schreibt er über Guyana nach dem Ersten Weltkrieg: »(…) um diese Energien freizusetzen, bedurfte es notwendigerweise eines Prozesses der Selbstvergewisserung, der sich im Rahmen von rassialen Gruppen und nicht im Rahmen der ›Nation‹ vollzog.« Dieser Prozess »führte nicht zwangsläufig zu Konflikten zwischen den ›Rassen‹, verzögerte nicht die Bildung von Organisationen entlang der Klassenlinien und schwächte nicht den Kampf gegen den Kolonialismus« (»rassial« ist die Übersetzung von englisch »racial«). Die partikularen Identitäten der Nachkommen afrikanischer Sklaven und indischer Schuldknechte waren für ihn notwendig der Beginn für den universellen Kampf gegen Unterdrückung.
Allerdings ist der erste Teil des Buches eher etwas für Kenner der Geschichte marxistischer Debatten. Der zweite und dritte Teil des Bandes zur Frage von Unterentwicklung und kolonialer Bildung sind anschaulicher und viel besser lesbar. Besonders empfohlen sei der Text »Die historischen Wurzeln der afrikanischen Unterentwicklung«. Er enthält komprimiert zentrale Inhalte von »Wie Europa Afrika unterentwickelte«, Rodneys einflussreiches Geschichtsbuch für die Massen von 1972.
Armut und wirtschaftliche Schwäche sind demnach Spätfolgen der kriegsähnlichen Verwüstung durch die transatlantische Versklavung von zwölf bis 15 Millionen Menschen zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert. Die moderne Kolonisierung Afrikas ab der Berliner Konferenz 1884/1885 hat strategisch den Transfer moderner Technik und die eigenständige Entwicklung verhindert. Statt Fabriken wurden billige europäische Konsumgüter exportiert, Afrika sollte billige Rohstoffquelle bleiben. Die afrikanischen Eliten und Kleinbürger waren Profiteure der Unterentwicklung und taugten deshalb nicht als Bündnispartner für den antikolonialen Kampf – darauf hat Rodney unermüdlich hingewiesen: »(…) sie kontrollieren kein Kapital. Bestenfalls besitzen sie zwei oder drei Häuser, einen Mercedes-Benz und einen Volkswagen.« Sie seien eine »Schicht innerhalb der internationalen Kapitalistenklasse«. Damit richtete er sich gegen die Idee von afrikanischen Führern, die entweder keine Klassengegensätze erkannten oder ein Bündnis mit einer nicht vorhandenen antikolonialen Bourgeoisie anstrebten.
Diese Positionen sind Ergebnis jahrelanger Forschungsarbeit und Teil eines Kampfes gegen koloniale Geschichtsschreibung. Rodney wurde 1966 an der angesehenen, doch zutiefst kolonialistischen School of Oriental and African Studies (SOAS) der Universität London promoviert, im Alter von gerade mal 24 Jahren. Dann lehrte er an der Universität von Daressalam in Tansania, einem damaligen internationalen Hotspot sozialistischer Debatten. Pünktlich zum weltbewegten Jahr 1968 wurde er Dozent in Jamaika und wirkte als intellektueller Aktivist in die machtvolle »Black Power«-Bewegung in den USA und der Karibik. Seine Bedeutung ist daran ablesbar, dass eine Einreiseverweigerung durch die jamaikanische Regierung nach seiner Teilnahme an einer Konferenz in Kanada zu einem tagelangen Aufstand der revolutionären jamaikanischen Studierenden führte, den »Rodney Riots«.
Im vierten Teil des Buches, »Den Sozialismus aufbauen«, findet sich Rodneys Auseinandersetzung mit den Ideen des damaligen »afrikanischen Sozialismus«. In Tansania wurde von 1967 bis 1985 unter Präsident Julius Nyerere versucht, mit egalitären und effizienten Dorfgemeinschaften (Ujamaa) einen Sozialismus zu schaffen, der nicht auf einem vorherigen städtischen und industriellen Kapitalismus aufbaut. Rodney diskutiert in einem Text von 1972 kenntnisreich und differenziert die Parallele zu Marx’ und Engels’ vorsichtiger Unterstützung ähnlicher Ideen von Sozialisten in Russland. Er schreibt zweckoptimistisch solidarisch, zeigt aber in diesem Fazit seine Unsicherheit: »Angesichts der Behauptung, dass bestimmte Intellektuelle so sehr in Tansania verliebt sind, dass sie ihre kritische Funktion aufgeben, möchte ich klarstellen, dass dies kein Lobgesang ist.«
Drei Jahre später findet er im Vortrag »Klassenwidersprüche in Tansania« in Chicago offene, bittere Worte für die autoritäre und bürokratische Umsetzung der Ujamaa, mit gewaltsamen Umsiedlungen der Menschen auf dem Land: »Auf der ganzen Welt haben wir schon oft erlebt, dass bestimmte Personen anderen Personen erklären, was gut für sie sei und dass sie notfalls zu ihrem eigenen Besten umgebracht werden müssten.« Ein linkes Projekt gegenüber Reaktionären verteidigen und zugleich jene aufklären, die es romantisieren, sind für Rodney »zwei verschiedene Übungen«. Wie können sich Linke heute solidarisch und realitätstauglich auf unklare linke Aufbrüche beziehen? Auch für diese Frage sind die fast vergessenen Erfahrungen und Debatten der 1970er Jahre wichtig.
Walter Rodney: Dekolonialer Marxismus. Schriften aus der panafrikanischen Revolution. Herausgegeben von Asha Rodney, Patricia Rodney, Ben Mabie und Jesse Benjamin. Mit einem Vorwort von Ngugi wa Thiong’o. Aus dem Englischen von Christian Frings. Dietz-Verlag, Berlin 2024, 320 Seiten, 29 Euro
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ähnliche:
 Gradel Muyisa Mumbere/REUTERS06.02.2025
Gradel Muyisa Mumbere/REUTERS06.02.2025Erst schießen, dann verhandeln
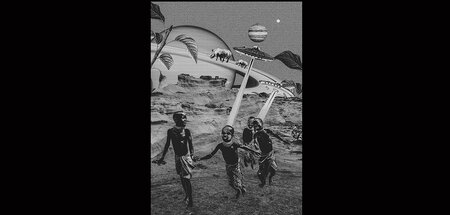 Thais Silva03.07.2024
Thais Silva03.07.2024De Gaulles vergiftetes Geschenk
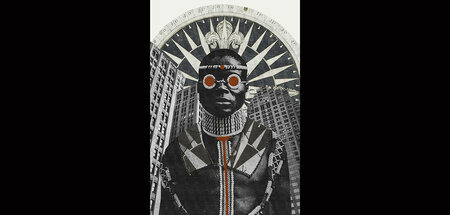 Thais Silva03.07.2024
Thais Silva03.07.2024Sozialismus und grüner Kapitalismus
Regio:
Mehr aus: Feuilleton
-
Rotlicht: Kredit
vom 26.03.2025 -
Nachschlag: Einen zum Abgewöhnen
vom 26.03.2025 -
Vorschlag
vom 26.03.2025 -
Veranstaltungen
vom 26.03.2025 -
Vier Druckfehler
vom 26.03.2025 -
Holland-Moritz, Pietsch, Jurichs
vom 26.03.2025 -
Frieden sichern
vom 26.03.2025 -
Spur der Steine
vom 26.03.2025 -
Er kennt keinen Schmerz
vom 26.03.2025
