Das Buch als Merch
Von Stefan Heidenreich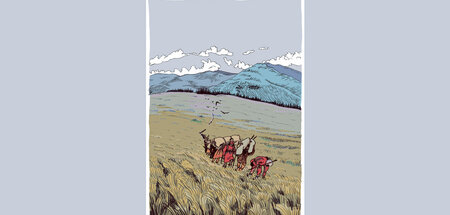
Seit in digitalen Kanälen so gerne mündlich gedacht und erzählt wird, hat sich der Stellenwert des Buches verändert. Es wird zu einem Anhängselprodukt des andauernden Geredes. Das muss nicht einmal schlecht sein, jedenfalls wenn man den ersten Philosophen glauben will.
Dass Waren bisweilen einen mystischen Charakter annehmen, ist bekannt. Dass diese Mystik mit Wert oder Gebrauch wenig zu tun hat, erschließt sich von selbst. Fraglich ist, ob das, was heute als »Merch« bezeichnet wird, ebenfalls unter diese Verzauberung des Alltäglichen fällt. Dann wäre »Merchandising« nichts anderes als eine neue Volte des Fetischcharakters der Ware.
*
Lange hat man geglaubt, dass der Wille zur Distinktion genügt, um den Geltungskonsum anzutreiben. Ganze Warenklassen beziehen ihre Wertschätzung einzig und allein aus dem individuellen Drang zum Unterschied. Das leuchtende Beispiel für ein solches Geltungsprodukt auf Massenbasis waren die Sneaker. Die Plastikschuhe mit einem Materialwert von kaum einem Euro wurden zu fanatisch verehrten Objekten. Zum Fetisch fehlt nur noch das Religiöse. Als Ersatzgott taugt der Markenname der Firma nicht.
Beim Geltungskonsum kehrt sich die Gebrauchsfunktion vollständig um, wie Thorstein Veblen gezeigt hat. Er vergleicht diese Umkehrung mit einem Potlatsch, einem Fest der nordamerikanischen Ureinwohner, bei dem wertvolle Geschenke ausgetauscht werden. Mit dem bezahlten Preis steigt die Wertschätzung. Wie bei einem Opfer steigert das Ausmaß an Verschwendung das errungene Prestige. Das gilt nicht nur für die oberen Einkommensklassen. Die Vorstädte der mittleren Klassen sind von einer besonderen Form des Landschaftspotlatsches geprägt. Der sogenannte Rasen ist nichts anderes als ein Kult der Bodenverschwendung, bei dem auch der kleinste Bürger noch zeigen darf, dass er es nicht nötig hat, auf seiner Parzelle Kartoffeln anzupflanzen. Er kann sie mit unnützem Gras verschwenden.
*
»Merch« fällt in eine ähnliche Kategorie entfunktionalisierter und überhöhter Waren. Nur kommen sie noch profan daher. Es fehlt sowohl die Verehrung wie beim Fetisch wie auch die Verschwendung des Potlatschs. »Merch« kommt mit seinem Charakter eines Anhängsels ganz alltäglich daher. Und doch ändern sich die Verhältnisse, wenn das Warending zum bloßen Mitbringsel wird. Das gilt nicht nur für Objekte wie bedruckte Werbegeschenke, sondern greift auch auf den Bereich der Kulturgüter über, besonders auf alle jene Teile des kulturellen Leben, die digital überformt wurden. Dazu gehören nicht nur Bücher, sondern auch Filme und Musik.
*
Ob sie wollen oder nicht, als dinghafte Waren geraten all die alten Kulturgüter langsam, aber unvermeidlich in den Sog des sogenannten Merch. Bei den Druckwerken hat diese Verschiebung mit den sogenannten Coffee Table Books begonnen. Sie sehen noch aus wie Bücher, aber eigentlich handelt es sich um bedruckte Einrichtungsgegenstände, die man dekorativ herumliegen lässt. Sie waren nur der Anfang. Marshall McLuhan meinte, dass die alten Medien immer zum Inhalt der neuen werden. Aber damit hört die Geschichte nicht auf. Denn danach wird das Alte entkernt.
*
Seit das Denken und das Erzählen allerlei neue Kanäle und Formate erschließen, hat das Buch sein altes Privileg verloren, der wichtigste Weg zu Gedanken und Geschichten zu sein. Lang hat man befürchtet, dass die sogenannte Aufmerksamkeitsspanne der verblödeten Jugend nicht über die durchschnittliche Laufzeit eines Tik-Tok-Videos hinauskommt. Seit aber stundenlange Podcasts Millionen von Zuschauern anziehen, lässt sich diese kulturpessimistische Perspektive nicht mehr halten.
*
Selbst was die Produktion von Fiktion anbelangt, gerät das Buch in Bedrängnis. Das Erzählen sucht sich neue Wege. An die Stelle der alten Romane treten neue Formen des Fiktiven. Dass man sie verabscheut und vor ihnen warnt, ist nichts Neues. So hört man überall Klagen über das Überhandnehmen von Fake News und Verschwörungstheorien. Dabei entstehen genau hier neue Formate fiktionalen Erzählens.
*
Selbst das Verhältnis von Büchern zum Denken erscheint nun zweifelhaft. Bis vor einiger Zeit, genauer gesagt bis vor dem Aufkommen digitaler Medien, galt noch die Gewissheit, dass wahrhaft »tiefe Gedanken« sich vorzugsweise auf Papier und zwischen Buchdeckeln finden. Radio oder Fernsehen hatten diese Vorstellung zwar schon prekär gemacht, aber an der Verehrung des Buchs als Gipfel des Denkens nichts geändert. Wenn es um Wahrheit und Wissen ging, galten schreibende Professoren als das Maß aller Dinge und alle anderen als dahergelaufene Laberköpfe.
Das war nicht immer so. Als das Aufschreiben von Gedachtem noch etwas Neues war, sah man das Verhältnis von Schrift und Weisheit gerade umgekehrt. Damals galt das Sprechen als Ausdruck vollendeter Weisheit. Als die Schrift aufkam, hat sie das Denken erst einmal ruiniert. Seither, so führt es Sokrates in Platons Phaidros-Dialog aus, ist die Weisheit von einst vergangen. Denn unter Bedingungen des Schreibens können die denkenden Menschen nur noch hoffen, »Freunde« der Weisheit zu werden. Zur Tiefe der »Weisen« von einst können sie nicht mehr zurück. Seither sind die Denker zu bloßen Freunden der Weisheit herabgestuft worden, »Philo-Sophen« im Wortsinn. Bekannt sind diese Überlegungen freilich nur, weil Platon sie in einem Akt des Verrats schriftlich festgehalten hat. Ansonsten hätten Nichtleser die Pflicht, aber auch die Freiheit, sie immer wieder selbst zu denken, oder eben auch nicht.
Sokratisch gesprochen, vegetieren die Denker seitdem an der langen Leine der Schrift im beklagenswerten Zustand des Philosophierens dahin. Man könnte also den Wandel des Buches zum Merch und die Abkehr des Denkens vom Schreiben geradezu als eine Art von Befreiung verstehen. Endlich, so würde eine KI Sokrates denken lassen, entkommt das Denken den Buchdeckeln, um zurück zum gesprochenen Wort zu finden, und damit zu dem, was die alten Griechen einmal Weisheit genannt haben.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Rotlicht: Kredit
vom 26.03.2025 -
Nachschlag: Einen zum Abgewöhnen
vom 26.03.2025 -
Vorschlag
vom 26.03.2025 -
Veranstaltungen
vom 26.03.2025 -
Vier Druckfehler
vom 26.03.2025 -
Holland-Moritz, Pietsch, Jurichs
vom 26.03.2025 -
Frieden sichern
vom 26.03.2025 -
Spur der Steine
vom 26.03.2025 -
Er kennt keinen Schmerz
vom 26.03.2025
