Kolonial verflochten
Von Fallon Tiffany Cabral, Rut-Lina Gonçalves Schenck, Maex Kühnert und Dayana Lau
Die Entstehung der Sozialen Arbeit in Deutschland und Europa ist eng mit kolonialen Herrschaftsstrukturen verwoben. Im Forschungsprojekt »Soziale Arbeit als koloniales Wissensarchiv?« nehmen wir diese Verflechtungen in den Blick und untersuchen, wie sich die Ursprünge der Profession im Kontext des deutschen Kolonialismus entwickelten und welche Spuren dies hinterlassen hat. Wir betrachten die Soziale Arbeit als historisch gewachsenes Wissensarchiv, in dem koloniale Denkweisen bis heute fortleben.
Darüber hinaus geht es uns darum, verdeckte – bisher ausgeklammerte – widerständige Schwarze (deutsche) Menschen, nicht weiße¹ und Personen mit Bezügen zu von Europa kolonisierten Ländern als Handelnde im weiteren Kontext Sozialer Arbeit in Deutschland aufzuspüren und mitzudenken, wenn wir historiographisch arbeiten. Sogenannte Hidden Figures und Organisationen zu identifizieren und ihr Wirken sichtbar zu machen, die in dominanten Erzählungen von Sozialer Arbeit als weiß imaginiertes Arbeitsfeld lediglich als »passiv« und »hilfsbedürftig« oder als »Opfer« dargestellt werden, betrachten wir als eine notwendige Aufgabe, um diese Erzählungen zu unterbrechen.
Fest eingebunden
Wir sehen uns diese Spuren da an, wo sie uns begegnen, zum Beispiel im Archiv, genauer gesagt den Archivalien des Alice-Salomon-Archivs der ASH Berlin (ASA), sowie vor den Türen des ASA, auf dem Gelände des Pestalozzi-Fröbel-Hauses (PFH) in Berlin-Schöneberg. Sowohl das PFH als auch die Soziale Frauenschule, die heute als Alice-Salomon-Hochschule in Berlin-Hellersdorf fortbesteht, weisen koloniale Verflechtungen auf, die bisher noch wenig aufgearbeitet sind.
Die Schöneberger »Soziale Frauenschule« zum Beispiel, die Alice Salomon 1908 als erste interkonfessionelle Sozialarbeitsschule in Deutschland ins Leben gerufen hat, entstand in einer Zeit, in der sich der »Frauenbund der deutschen Kolonialgesellschaft« gründete sowie verschiedene koloniale Frauenschulen an der Schnittstelle der bürgerlichen, weißen Frauenbewegung und den kolonialen Bewegungen und Verbänden entstanden. Letztere dienten dazu, weiße Frauen auf ihre Rolle als »Trägerin deutscher Kultur« in den Kolonien vorzubereiten; mit Unterricht in Hauswirtschaft, Pädagogik, Krankenpflege und »Völkerkunde«. Dabei waren nationale und koloniale Ideologien fest in das Curriculum eingebunden. Frauen wurden als »Mütter der Nation« ausgebildet, um die koloniale Ordnung zu stabilisieren und europäische Wertvorstellungen in den Kolonien zu verbreiten.
Wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, verwundert dies nicht, weil die moderne Soziale Arbeit als Beruf zur gleichen Zeit entstand, in der Deutschland zur Kolonialmacht wurde. Im Jahr 1893, als europäische Länder unter deutscher Führung den afrikanischen Kontinent unter sich aufteilten, gründeten Mitglieder der Berliner bürgerlichen Frauenbewegung die »Mädchen- und Frauengruppen für soziale Hilfsarbeit«. Diese wurden zum Ausgangspunkt der Ausbildung und Praxis der Sozialen Arbeit, wie wir sie noch heute kennen. Viele Pionierinnen der Sozialen Arbeit engagierten sich gleichzeitig in der kolonialen Bewegung und verknüpften soziale Initiativen mit kolonialen Interessen.
Lücken im Archiv
In den Archiven finden sich Spuren dieser Geschichten, aber auch große Lücken. Insbesondere fehlen die Stimmen derjenigen, die von den deutschen »Zivilisierungsmissionen« in den damaligen Kolonien adressiert wurden, und die Stimmen derjenigen, die sich widerständig zeigten oder alternative Perspektiven auf die sozialen Interventionen der weißen Sozialarbeiterinnen entwickelten. Diese einseitige Überlieferung spiegelt nicht nur koloniale Machtverhältnisse wider, sondern erschwert auch eine kritische Rekonstruktion der Geschichte. Die Herausforderung besteht darin, diese Lücken sichtbar zu machen, hegemoniale Narrative zu hinterfragen und nach alternativen Quellen zu suchen – sei es durch mündliche Überlieferungen, Gegenerzählungen oder Markierungen dessen, was in den Archiven fehlt.
Widerständige Praktiken von BIPoC (englische Abkürzung für Schwarze, Indigene und People of Color, jW) im Zusammenhang mit der frühen Sozialen Arbeit und Pädagogik in Deutschland zu finden und als genuinen Bestandteil der Geschichte (sozial-)pädagogischer Berufe in Deutschland zu untersuchen, versuchen wir derzeit intensiv zu vertiefen. Dieses Vorhaben ist essentiell auf die (historiographischen Forschungs-)Arbeiten von Schwarzen und afrodiasporischen Communitys in Deutschland und darüber hinaus angewiesen. Solchen Initiativen haben wir es zu verdanken, dass es (machtkritische) Wissensproduktionen in Bezug auf die historische Präsenz und das (sozialarbeiterische) Wirken von Schwarzen, afrodiasporischen Menschen in Deutschland gibt.
So sind wir beispielsweise im Rahmen der Ausstellung »Solidarisiert euch! Schwarzer Widerstand und globaler Antikolonialismus in Berlin, 1919–1933«² in der Villa Oppenheim in Berlin-Charlottenburg auf die Existenz des Afrikanischen Hilfsvereins gestoßen. Er gründete sich am 1. Mai 1918 in Hamburg, um Schwarzen Menschen in Deutschland »das Gefühl der Vereinsamung inmitten der weißen Bevölkerung zu nehmen« und »eine Zentralstelle zu schaffen, die, soweit es überhaupt möglich ist, die (Gemeinschaft) und die Familie der Heimat« ersetzen sollte.³ Diese Tätigkeiten zählen wir heute ganz selbstverständlich zu den Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit, dennoch findet sich in den Geschichtsbüchern zur Sozialen Arbeit in Deutschland kein Hinweis auf diesen Verein.
Bei einem Besuch des Archivs von Each One Teach One e. V. (EOTO) in Berlin-Wedding sind wir auf die Spur von Regina Bruce/Savi de Tové gestoßen. Savi de Tové war eine Schwarze Sozialarbeiterin, die 1900 als Kind togoischer Eltern in Deutschland geboren wurde. Sie leitete in den 1920er Jahren in Hamburg-Groß Borstel zusammen mit einer Freundin ein Kinderheim für kriegsbedingt geflüchtete, mehrheitlich weiße deutsche Kinder. Anfang der 1930er Jahre ging sie mit ihren Schwestern Anni und Lisa nach Togo, um eine Schule für Mädchen unter der Trägerschaft der Norddeutschen Mission zu leiten. Auch zu Savi de Tové findet sich in den Chroniken der Sozialen Arbeit keine Spur.
Spuren finden
Diese Nachlässigkeit führt uns vor Augen, dass es nicht nur Verflechtungen der Sozialen Arbeit mit kolonialen Projekten damals gab, sondern Schwarze, afrodiasporische, asiatischdiasporische, sowie migrantische Präsenzen aus ehemaligen (deutschen) Kolonien in Afrika und Asien aus der Professionsgeschichte herausgeschrieben werden, während »White Saviorism«-Narrative – Entwicklungs-, Aufklärung-, oder Hilfsarbeit im globalen Süden leisten zu müssen – auch heute noch in Forschung und Ausbildung reproduziert werden.
In diesem Sinne und um dem strukturellen Entinnern etwas entgegenzusetzen, möchten wir die Lesenden bitten, uns bei der Suche nach Spuren von entinnerten Menschen zu helfen. Wir suchen Hinweise zu Schwarzen Menschen, afrodiasporischen, asiatischdiasporischen Menschen, sowie Eingewanderten aus ehemaligen (deutschen) Kolonien in Afrika und Asien, die zwischen 1870 und 1930 in Deutschland lebten und beruflich oder informell im Bereich der Sozialen Arbeit aktiv waren. Etwa in der Armenpflege, Wohlfahrtspflege oder Jugendfürsorge, in sozialen Bewegungen, Vereinen oder kirchlichen Organisationen; beruflich in der Sozialarbeit oder als Fürsorgende in verwandten Feldern wie Kinderheimen, Kindergärten oder Schulen; schließlich in Selbstorganisationen (z. B. Afrikanischer Hilfsverein), Gemeinschaftsräumen für nicht weiße Menschen oder anderen Netzwerken von Schwarzen Menschen und Eingewanderten.
Wenn Sie Informationen, Dokumente, Fotos oder Geschichten haben und mit uns teilen möchten, melden Sie sich bitte unter: kol-lab@ash-berlin.eu
Anmerkungen
1 Um kenntlich zu machen, dass es sich bei den Bezeichnungen »Schwarz« und »weiß« nicht um biologische Tatsachen handelt, wird »Schwarz« als Ausdruck einer politischen Selbstbezeichnung groß geschrieben, »weiß« wird kursiv gesetzt, um zu verdeutlichen, dass es sich um eine durch Machtverhältnisse geprägte, hegemonial gesetzte Position innerhalb eines rassistischen Systems handelt.
2 Die Ausstellung ist eine Kooperation des Projekts Dekoloniale Erinnerungskultur in der Stadt und des Museums Charlottenburg-Wilmersdorf, kuratiert von einem fünfköpfigen Team und gestaltet von Studio visual intelligence, unter Mitwirkung afrodiasporischer und dekolonialer Organisationen.
3 Statut des Afrikanischen Hilfsvereins, Staatsarchiv Hamburg 331–333, SA 2819
Zum Weiterlesen
alice-salomon-archiv.de/projekte/soziale-arbeit-als-koloniales-wissensarchiv/
»Dig where you stand«: Bewegung für archivische Gerechtigkeit dwys.co.uk/
Dörte Lerp: Die Kolonialfrauenschulen in Witzenhausen und Bad Weilbach (unveröffentlichte MA-Thesis)
Merle Bode: Biographie über Regina Bruce/Savi de Tové: kurzlinks.de/dekoloniale
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ähnliche:
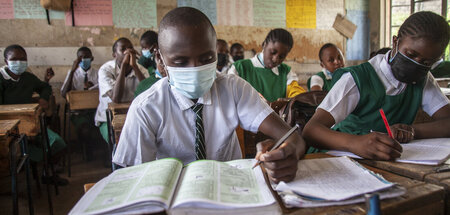 Kelvin Juma26.02.2025
Kelvin Juma26.02.2025Mörderische Tradition
 Christian Spicker/imago images17.12.2024
Christian Spicker/imago images17.12.2024Frühere Bundestagsabgeordnete Christine Buchholz tritt aus der Partei Die Linke aus
 Heritage Images/IMAGO23.11.2024
Heritage Images/IMAGO23.11.2024Der »Vorzeige-Askari«
Regio:
Mehr aus: Inland
-
BRD macht durchweg Minus
vom 26.02.2025 -
»Vom Arbeitsamt wurde ich gesperrt«
vom 26.02.2025 -
Großer Geldsegen für den Krieg
vom 26.02.2025 -
Staatliche Machtdemonstration
vom 26.02.2025 -
Kriegsjubel in »Blau-Gelb«
vom 26.02.2025 -
Berliner Senat legt die Axt an
vom 26.02.2025 -
»Der Klimawandel trifft immer die Armen«
vom 26.02.2025 -
Milliarden verbrannt
vom 26.02.2025
