Die Moral aus der Geschichte
Von Marc Püschel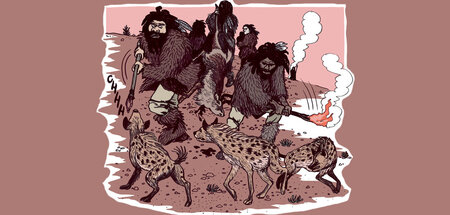
Die Moral hat in unserer Zeit keinen guten Leumund. Nicht selten ist die öffentliche Kritik an ihr auch berechtigt – insofern mit Moral Politik gemacht wird. Die eine Seite der Gleichung einfach zu streichen und nur noch Politik stehen zu lassen, ist nur scheinbar radikal. Wo Politik jede moralischen Zielsetzungen sein lässt, verfällt sie in eitle Spielerei oder Nihilismus. Noch der oft zur Bibel des Amoralismus stilisierte »Fürst« Machiavellis endet mit einer nicht anders als moralisch begründbaren Hoffnung: Ein Fürst möge Italien vereinigen und ihm eine Form geben, die »dem gesamten Volke zum Segen gereicht«. So wäre vertieftes Nachdenken über unsere ethischen Prinzipien angemessener, als mit Moralkritik hausieren zu gehen.
Um so spannender also, dass nun mit Thomas Nagel jemand einen Neuansatz auf dem Gebiet wagt, der dafür bekannt ist, philosophischen Diskussionen oft neue, unerwartete Richtungen zu geben. Berühmt wurde etwa sein Aufsatz »What Is It Like to Be a Bat?« aus dem Jahr 1974. Darin verweist er darauf, dass, egal wie gut wir ihr Echoortungssystem aus wissenschaftlicher Perspektive auch verstehen mögen, wir nie wissen können, wie sich diese Form der Wahrnehmung für Fledermäuse anfühlt. Der Beitrag zog eine jahrzehntelange Diskussion in der angelsächsischen Philosophie rund um mentale Prozesse und ihr subjektives Erleben nach sich.
Nicht weniger überraschend war sein Plädoyer für ein teleologisches Weltverständnis in dem Werk »Geist und Kosmos« von 2012. Die etablierte naturwissenschaftliche Weltsicht, so Nagel, scheitere immer noch daran, das Entstehen von Leben und die folgende erstaunlich schnelle Entwicklung hin zum menschlichen Geist vollständig nachvollziehen zu können. Man müsse davon ausgehen, dass die Entwicklung des Kosmos wesentlich zielgerichteter erfolgt als angenommen. Was auch immer man davon halten mag, zumindest weisen mittlerweile auch wissenschaftliche Experimente darauf hin, dass sich im Zuge evolutionärer Prozesse auch die Fähigkeiten von Organismen verfeinern, sich an zukünftige und nicht nur gegenwärtige Umweltbedingungen anzupassen.
Hohe Erwartungen knüpfen sich also an Nagels neues Werk »Moralische Gefühle, moralische Wirklichkeit, moralischer Fortschritt«. Das Bändchen besteht aus zwei Essays, die auf Vorträgen aus den Jahren 2015 und 2016 basieren. Der erste »Bauchgefühle und moralisches Wissen« fällt mit 30 Seiten sehr kurz aus und rekonstruiert im wesentlichen den Gegensatz zwischen konsequentialistischen und deontologischen Ethiken – also zwischen Ethiken, die Handlungen danach bewerten, ob ihre Folgen gut oder nützlich sind (z. B. Utilitarismus), und Ethiken, die Handlungen rein nach dem Willen bzw. der Handlungsabsicht bewerten (z. B. Kants Ethik).
Nagels vorsichtige Überlegungen zur »Pattsituation« zwischen den beiden Formen von Ethiken sind klug, aber kaum grundstürzend. Relevant sind jedoch einige Bemerkungen, die zum Ende hin fallen und Vorlage für die Entwicklung der Gedanken des zweiten Essays wurden. Über die Bemerkung, dass sich unser Wissen über Moral im Laufe der Zeit offenkundig ändert, stößt Nagel auf die Frage, was überhaupt als moralischer Fortschritt gelten könne. Er behandelt die Frage im ersten Essay nicht weiter, weist aber mit einem interessanten Beispiel darauf hin, worin er moralischen Fortschritt sehen würde: »Eine Reform in der moralischen Auffassung von Eigentum würde bedeuten, dass Eigentumsrechte gemeinhin nicht so gesehen würden, als beruhten sie auf individueller Freiheit, sondern auf dem kollektiven Wohl.« Eine Eigentumskonzeption aber, die das allgemeine Wohl stärker fokussiert als partikulare Eigentumsrechte, würde »ein klares Beispiel für Fortschritt sein«.
Der wichtigere Part ist dementsprechend der zweite, deutlich längere Essay »Moralische Wirklichkeit und moralischer Fortschritt«. Obgleich Nagel ein platonisches Verständnis ablehnt, das dem Guten einen ontologischen Status zuspricht, plädiert er für einen Realismus: Moralische Aussagen sind objektiv wahr oder falsch und hängen nicht von unserem subjektiven Glauben ab. Dennoch kommt ihnen nicht derselbe Status zu wie naturwissenschaftlichen Aussagen, denn diese betreffen Sachverhalte, die es auch ohne Menschen gibt. So gibt es gute Gründe dafür, warum Menschen in der Antike die Relativitätstheorie noch gar nicht begreifen konnten – das ändert nichts an ihrer Wahrheit.
Moralische Aussagen dagegen, so Nagel, lassen sich in ihrem Wahrheitsgehalt nicht von den Gründen trennen. Das führt zu einer wichtigen Differenzierung: »Manchmal wird sich der moralische Fortschritt als die Entdeckung von etwas ausweisen lassen, das stets schon wahr gewesen ist; manchmal aber auch nicht.« Denn ein moralisches Urteil wird wahr oder falsch durch die Gründe, die zu seiner Einsicht vorliegen. Als Beispiel wählt Nagel etwa die Akzeptanz von Homosexualität als einen Fall moralischen Fortschritts. Dabei sei etwas anerkannt worden, das immer schon moralisch wahr war, denn die biologische Funktion von Sex für die Fortpflanzung liefert an sich noch keinen Grund, andere Formen der Sexualität zu verurteilen, und dies war zu jedem Zeitpunkt der Geschichte auch prinzipiell einsichtig.
Als Gegenbeispiel dient Nagel das Recht auf freie Meinungsäußerung. Die Einsicht in die Gründe, die für dieses sprechen, wurden laut dem US-Philosophen erst mit der historischen Entwicklung der modernen politischen Legitimierung des Staates durch das Gesamt der Staatsbürger möglich. Freie Meinungsäußerung zuzulassen sei daher eine moralische Wahrheit, die erst im Laufe der Geschichte selbst wahr wurde. Denn vor den Revolutionen des 18. Jahrhunderts seien die Bedingungen für das Verständnis der Gründe für Redefreiheit nicht gegeben gewesen.
Mit dieser Differenzierung wählt Nagel einen klugen Mittelweg zwischen einem quasi platonischen »Ideenhimmel« moralischer Wahrheiten einerseits und einem völlig subjektiv-relativistischen Verständnis von Ethik andererseits. Freilich, der Weg wird nur angedeutet, die offenen Fragen, die sich beim Lesen der Essays ergeben, und die möglichen Einwürfe sind Legion. Doch philosophischer Fortschritt liegt nicht in fertigen Antworten, sondern im Aufwerfen der richtigen Fragen. Nagels Genie liegt darin, neuralgische Punkte philosophischer Diskussionen zu treffen. Sein Moralbändchen könnte nicht weniger einflussreich werden als sein Fledermausaufsatz.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ähnliche:
 CPA Media/IMAGO03.08.2024
CPA Media/IMAGO03.08.2024Unter der Voraussetzung der Feindschaft
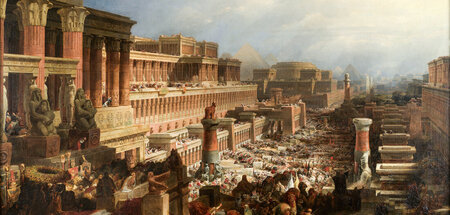 Wikimedia Commons18.06.2024
Wikimedia Commons18.06.2024Einsam in der Wüste
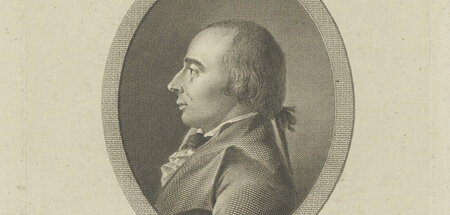 Universitätsbibliothek Leipzig, Germany / Public Domain16.12.2023
Universitätsbibliothek Leipzig, Germany / Public Domain16.12.2023Ein großer Causeur
Mehr aus: Feuilleton
-
Rotlicht: Kredit
vom 26.03.2025 -
Nachschlag: Einen zum Abgewöhnen
vom 26.03.2025 -
Vorschlag
vom 26.03.2025 -
Veranstaltungen
vom 26.03.2025 -
Vier Druckfehler
vom 26.03.2025 -
Holland-Moritz, Pietsch, Jurichs
vom 26.03.2025 -
Frieden sichern
vom 26.03.2025 -
Spur der Steine
vom 26.03.2025 -
Er kennt keinen Schmerz
vom 26.03.2025
