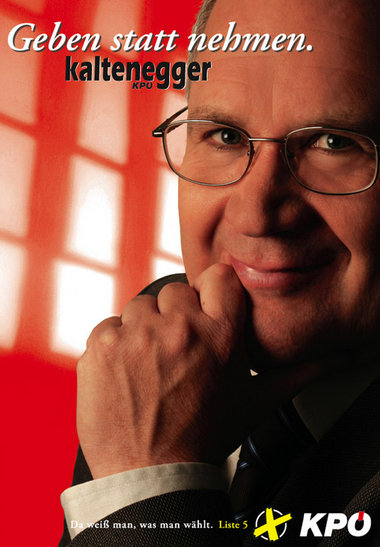Der Diplomphilosoph Arnaldo Otegi, geboren 1958, ist Sprecher der seit 2003 in Spanien verbotenen baskischen Linkspartei Batasuna (Einheit) und führender Vertreter der Unabhängigkeitsbewegung des Baskenlandes; langjähriges Mitglied des Autonomieparlaments in drei baskischen Provinzen; ehemaliges Mitglied der Untergrundorganisation ETA, politischer Flüchtling in Frankreich, nach Auslieferung durch Paris 1987 in Madrid verurteilt zu sechs Jahren Gefängnis wegen angeblicher Beteiligung an einer Entführung. Seit 2006 ist er Mitglied der Batasuna-Verhandlungskommission im baskisch-spanischen Friedensprozeß. Otegi ist eingeladen zur Rosa-Luxemburg-Konferenz am 13. Januar in Berlin.
Danke zunächst, daß Sie der Einladung von junge Welt und Cuba Si zur Rosa-Luxemburg-Konferenz folgen wollen. Allerdings gab und gibt es bekannterweise einen kleinen Haken für Ihre Teilnahme: Sie mußten beim Obersten Gerichtshof (Audienca Nacional) in Madrid eine Genehmigung für Ihre Reise nach Berlin einholen. Was macht Sie so gefährlich für den spanischen Staat?
Offiziell laufen noch einige Verfahren gegen mich, unter anderem wegen »Beleidigung des Königs«. Sie stammen aus der Regierungszeit des erzkonservativen Premierministers José Maria Aznar – und damit aus jener Periode, in der sich George W. Bush und sein spanischer Freund Aznar aufmachten, den »internationalen Terrorismus« zu bekämpfen. Zu dem zählten sie auch uns. Gefährlich sind wir aber vor allem, weil wir ein Konzept erarbeitet haben, wie der politische Konflikt im Baskenland politisch gelöst werden kann. Und: Wir bieten eine Alternative für eine zukünftige, soziale Gesellschaft an. Bekannt ist, daß derjenige, der so etwas tut, den Herrschenden generell ein Dorn im Auge ist – und also eine Gefahr darstellt.
Wie hat das Gericht auf Ihr Begehren reagiert, vom 12. bis 14. Januar in die deutsche Hauptstadt zu fliegen, um dort über eben jenes alternative Konzept für ein anderes Gesellschaftskonzept zu referieren?
Mein Reiseantrag wurde von der Audienca Nacional definitiv abgelehnt. Trotzdem arbeiten wir an einer Möglichkeit, damit ich in Berlin doch noch zu Wort komme.
Ihr Auftritt am 13. Januar steht weiter auf der Tagesordnung. Der Zeitraum zwischen 15 und 16 Uhr bleibt für Sie reserviert.
Natürlich würde ich äußerst gern an der prestigereichen, revolutionären Rosa-Luxemburg-Konferenz teilnehmen, aber derzeit sieht es tatsächlich so aus, als wenn es nicht geht. Leider hat sich wieder einmal herausgestellt, daß das so oft proklamierte »Europa der freien Reise«, das grenzenlose Europa, nicht für alle gilt. Trotzdem werde ich mich in irgendeiner Form einbringen.
Welches sind die Themen, die Sie behandeln wollen?
Es geht zum einen um unser politisches Projekt. Dieses handelt im Kern von einem unabhängigen, fortschrittlichen Baskenland und ist ein Kann-Projekt. Das heißt, daß es das nur geben wird, wenn es die Leute wollen. Insofern treten wir für das vielzitierte »Europa der Urnen« ein, in dem alles abstimmbar ist. Auch die baskische Bevölkerung soll in allen Bereichen, in denen sie lebt, darüber entscheiden können, welches Projekt sie sich in Zukunft wünscht. Kurz: Es geht um das Recht auf Selbstbestimmung. Das wird ihr derzeit verwehrt. Dabei ist uns klar, daß letztlich eine linke Alternative für unser Land von linken Alternativen für Europa nicht zu trennen ist – das zweite Thema meines Referats. Mit großem Interesse beobachten wir derzeit die Entwicklungen in Lateinamerika, wo sich die linken Kräfte im Aufwind befinden. Das kann auch für uns in Europa ein Ansporn sein. Wir können davon lernen.
Wenn sich Marxisten unterschiedlicher Richtungen auf Foren wie der Rosa-Luxemburg-Konferenz treffen, geht es sicherlich darum, gemeinsam darüber nachzudenken und eine Strategie zu planen, wie ihre Vorstellungen letztlich realisierbar sind. Also: Wie können wir den Sozialismus in Europa auf die Tagesordnung bringen?
Wie wollen Sie Ihr Referat auf der Konferenz einbringen, wenn Sie nicht persönlich anwesend sein dürfen?
Denkbar wäre eine Videoschaltung vom Baskenland nach Berlin. Und wenn die staatliche Repression auch dieses nicht zuläßt, dann schicke ich einen Brief aus dem Knast.
Es scheint, als würde die staatliche Repression gegen die Linke im Baskenland nach dem fatalen Autobombenanschlag, der den Madrider Flughafen Barajas am 30. Dezember erschütterte, wieder zunehmen. Der baskisch-spanische Friedensprozeß befindet sich in der Krise und droht zu scheitern. Trotzdem meinten Sie jüngst, der sei »nicht kaputt«. Was bewegte Sie zu dieser Hoffnung?
Der Friedensprozeß steckt zweifelsohne in einer enormen Krise. Nunmehr geht alles darum, dessen momentane strukturelle Blockierung zu durchbrechen. Wir sind davon überzeugt, daß es zu einer politischen Lösung des weiter bestehenden Konfliktes keine Alternative gibt. Jeder andere als der politische Weg ist auf Sand gebaut. Wir müssen nun in dieser komplizierten Lage versuchen, die Fahne der Verständigung hochzuhalten. Das heißt für uns, mit allen Seiten und mit allen Leuten zu besprechen, wie wir aus der Krise herauskommen. Eine politische Dialoglösung ist unverzichtbar. Es kann allerdings nicht angehen, daß immer von einer »politischen Lösung« des Konflikts gesprochen wird, aber eine der beteiligten politischen Parteien unter undemokratischen Verhältnissen arbeiten muß und von der demokratischen Arbeit ausgeschlossen wird.
Sie meinen damit das – trotz Verhandlungen mit deren Vertretern – weiter existierende Verbot von Batasuna?
Ja. Das paßt nicht zusammen.
Sie selbst haben 2004 vor 15000 Menschen im Velodrom von Donostia (San Sebastian) die aufsehenerregende Initiative für eine Lösung des damals verfahrenen baskisch-spanischen Konflikts präsentiert – weg von der bewaffneten hin zur politischen Auseinandersetzung durch Initiierung eines Dialogs zwischen Madrid und ETA einerseits sowie eines parallelen Prozesses aller politischen Kräfte auf Ebene des gesamten Baskenlandes. Am 22. März 2006 begann dann auf Grundlage dieser Idee mit dem ETA-Waffenstillstand der eigentliche Friedensprozeß. Dieser scheint nun nach nur neun Monaten beendet. Und inzwischen existieren zumindest Zweifel an dessen grundsätzlicher Substanz. Wie ist er verlaufen?
Zu Beginn des Prozesses gab es zunächst eine Phase, in der Bedingungen diskutiert wurden, wie er insgesamt ablaufen könnte. Dafür wurden monatelang Gespräche geführt – auch mit dem Staat. Das kann man nicht so abtun, als wenn nichts gewesen wäre. In dieser Phase wurden einige Eckpunkte festgelegt, die unabdingbar waren, damit sich der Prozeß überhaupt entwickeln konnte. Nur leider wurden diese Verbindlichkeiten dann zunehmend von staatlicher Seite nicht eingehalten.
Was meinen Sie konkret?
Zum Beispiel die erwähnte Abmachung, demokratische Verhältnisse zu schaffen und für eine gleichberechtigte Teilnahme aller Beteiligten zu sorgen. Statt dessen versuchte die Regierungsseite, den Prozeß für Frieden und eine politische Normalisierung rein technisch zu behandeln und die politische Dimension auszuklammern. Das führte letztlich von der seit Monaten existenten kleineren Krise zur jetzigen schweren Krise. Wir befinden uns heute in einer Situation der Verunsicherung. Trotzdem bleibt eine politische Lösung möglich und unbedingt nötig. Zwingende Voraussetzung hierfür ist die Abwesenheit jeglicher Gewalt. Sie kann nur in einem Umfeld diskutiert werden, das gewaltlos ist. Durch eine Wiederbelebung der Gespräche kann der politische Prozeß wiederbelebt werden. Darum ringen wir.
Trotz dieses Anspruchs und obwohl Sie den Attentatsopfern und Angehörigen Ihr Mitgefühl ausgesprochen haben, wächst insbesondere der Druck auf die linke baskische Unabhängigkeitsbewegung. Drohen nun härtere Zeiten als vor Beginn des Friedensprozesses?
Die Gefahr, daß repressive Mittel ergriffen werden, ist real, und damit auch, daß wir Opfer von staatlicher Gewalt werden. Ein derartiges Vorgehen wäre allerdings nichts anderes die Neuauflage eines alten Konzepts, das nie gewirkt hat und auch diesmal nicht wirken wird. Die PSOE (Sozialistische Arbeiterpartei) weiß, daß der Konflikt nicht mit dem Mittel der Unterdrückung zu lösen ist. Damit sorgt sie lediglich für Auftrieb bei den frankistischen und faschistischen Kräften im spanischen Staat, stärkt diese und gefährdet die sozialdemokratische Linie selbst. Die PSOE kann letztlich nur erfolgreich sein, wenn sie versucht, den Konflikt politisch zu lösen. Unsere Aufgabe ist es, so schnell wie möglich wieder den Kontakt mit den Sozialdemokraten zu suchen und mit dafür zu sorgen, daß die Phase der Rückkehr zu den alten repressiven Mitteln so kurz wie möglich ist.
Die Repression betrifft auch Sie persönlich, wie das aktuelle Reiseverbot nach Berlin verdeutlicht. Sind weitere Maßnahmen gegen Sie als führenden Repräsentanten des Friedensprozesses zu erwarten?
Es sieht tatsächlich so aus, als ob das, was wir jetzt erleben, nur der Anfang von dem ist, was kommen wird.
Was ist schief gelaufen?
Die PSOE-Regierung hat den Prozeß insgesamt schlecht geleitet und sich anscheinend auf die nächsten Wahlen konzentriert, um als Friedensbringerin in die Geschichte einzugehen. Trotzdem muß sie auch jetzt daran interessiert sein, daß es zu einer politischen Lösung kommt. Bisher haben die Regierenden auf weitere Repression gesetzt, waren unbeweglich, versuchten, im rechten Lager Sympathien zu sammeln und zu zeigen, daß sie gegenüber ETA nicht klein beigeben. Leider war die PSOE nicht dazu in der Lage, im humanitären Bereich Erleichterungen einzuräumen – wie beispielsweise in der Frage der politischen Gefangenen. Kontraproduktiv war schließlich die Veröffentlichung eines Videos, in dem sie sich damit brüstete, keine Konzessionen gegenüber ETA gemacht zu haben. Oder anders: Sie brüsteten sich gar damit, weniger Zugeständnisse gemacht zu haben, als die Aznar-Regierung während der ETA-Waffenruhe 1998/99. Diese ließ seinerzeit tatsächlich einige Gefangene ins Baskenland verlegen. Es entstand zuletzt ein regelrechter Wettbewerb der PSOE mit der spanischen Rechten, wer wem weniger Zugeständnisse gemacht hat. Damit schadete die Regierungspartei ihren eigenen Interessen.
Nun heißt es, ETA hätte durch die Bombe von Madrid den Friedensprozeß zerstört und damit auch eine Verlegung der baskischen Gefangenen ins Baskenland verhindert. Diese hätte, so mutmaßte beispielsweise der Madrider Korrespondent der FAZ am Mittwoch, spätestens im Frühjahr 2007 begonnen. Angesichts des Attentats vom 30. Dezember allerdings drängt sich natürlich die Frage auf, warum Premier Zapatero nicht schon eher eine Geste des guten Willens gezeigt und beispielsweise die Situation der baskischen Gefangenen erleichtert hat. Was meinen Sie?
Die Frage haben wir uns auch oft gestellt. Warum haben sie es nicht gemacht? Wir können uns das nicht anders als mit wahltechnischen Überlegungen erklären. Oder damit, daß der Druck der rechten Volkspartei (PP) so stark war, daß die Regierung öffentlich nicht den Eindruck erwecken wollte, gegenüber ETA etwa »einzuknicken«. Trotzdem bleibt festzuhalten: Sie hätte, ohne auch nur das geringste an der Gesetzgebung ändern zu müssen, die politischen Gefangenen näher ans Baskenland verlegen können. Dieser Schritt wiederum hätte ein Klima befördert, das dem gesamten Prozeß förderlich gewesen wäre. Dieses nicht zu machen, war auch aus ihrer Sicht unintelligent. Es fällt schwer nachzuvollziehen, warum. Wir haben dafür keine Erklärung. Schlechter als die PSOE in den vergangenen Monaten kann man einen politischen Dialog nicht führen.
Nun warnte die baskische Seite in den vergangenen Monaten mehrfach vor einer weiteren Blockade des Friedensprozesses. Auch wurde im November und Dezember immer deutlicher: Der Unmut im Baskenland darüber, daß sich nichts Substanzielles tut, wächst. Und trotzdem kam das ETA zugeschriebene Attentat von Madrid für viele überraschend. Auch für Sie?
Ja. Es war zu diesem Zeitpunkt nicht damit zu rechnen. Generell allerdings weiß ich nicht, ob man von »Überraschung« sprechen kann, wenn bei einem längeren Prozeß verschiedene Grundvoraussetzungen mehrfach angemahnt und trotzdem nicht eingehalten werden. Zudem weiß man aus der Geschichte des Konflikts, wozu Ignoranz führen kann. Insofern kann man nicht grundsätzlich von Überraschung sprechen. Wenn allerdings der spanische Ministerpräsident noch am 29. Dezember absolut sicher auftritt und behauptet, der Prozeß laufe gut und es sei alles klar, und am 30. Dezember passiert solch ein Attentat, dann – tut mir leid – hat der Mann demonstriert, daß er sich eine absolute Fehleinschätzung geleistet hat.
Trotzdem kam auch für Sie das Attentat überraschend.
In der Tat. Und die nun entstandene Situation ist alles andere als wünschenswert. Der Prozeß gerät in eine noch tiefere Krise, und wir müssen jetzt sehen, wie wir mit den neuen Tatsachen umgehen. Dazu gehört zwar, erst einmal zu beraten, doch möchte ich an dieser Stelle zunächst den spanischen Regierungschef beim Wort nehmen. Dieser hat am 29. Dezember auch gesagt: Wir stehen jetzt besser da als vor einem Jahr, und in einem Jahr werden wir besser dastehen als jetzt. Ich nehme ihn also beim Wort und antworte: Dann gehe ich davon aus, daß wir am 29. Dezember 2007 besser dastehen als am 29. Dezember 2006. Auf dieses Ziel wollen wir hinarbeiten.
Das Gespräch führte Gerd Schumann in Donostia (San Sebastian)
Übersetzung: Stefan Natke